Bundesrat: zum Gesetzesentwurf zur Stärkung des fairen Wettbewerbs

Das Bundeskabinett hat am 15.05.2019 den Entwurf des Gesetzes zur Stärkung des fairen Wettbewerbs beschlossen. Lesen Sie in unserem Beitrag, welchen Beschlusstenor der Bundesrat in Bezug auf den Gesetzesentwurf verabschiedet hat.
Das gesetzgeberische Ziel bei diesem Gesetzesentwurf
Vorab: Den Gesetzesentwurf zur Stärkung des fairen Wettbewerbs können Sie hier einsehen.
Die Bundesregierung gibt als Begründung zum Gesetzesentwurf an, dass im Sinne eines fairen Wettbewerbs lauterkeitsrechtliche Regelungen eingehalten und Verstöße effektiv sanktioniert werden müssen. Abmahnungen dienen dabei der schnellen und kostengünstigen Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen, die eine teure und unter Umständen langwierige gerichtliche Auseinandersetzung vermeiden können.
Die geplanten Änderungen durch das neue Gesetz
Der Gesetzentwurf sieht zur Eindämmung missbräuchlicher Abmahnungen insbesondere eine Reduzierung der finanziellen Anreize für Abmahnungen vor.
Vor allem die nachstehenden Punkte sind Gegenstand des geplanten Gesetzes zur Stärkung des fairen Wettbewerbs:
- Abschaffung des „fliegenden“ Gerichtsstands
- Regulierung der Abmahnberechtigung
- Verbot rechtsmissbräuchlicher Abmahnungen
- Formale Anforderungen an eine Abmahnung
- Gegenanspruch bei unberechtigter Abmahnung
- Änderungen bei der Erstattung von Abmahnkosten
- Vorgaben an die Vereinbarung einer Vertragsstrafe
- Begrenzung des gerichtlichen Streitwerts auf 1.000,- Euro
Hinweis: Eine umfassende Darstellung zum Gesetzesentwurf und den geplanten Neuerungen können Sie in unserem Beitrag Gesetzesentwurf zur Eindämmung des Abmahnmissbrauchs - endlich Entlastung für Online-Händler? nachlesen!
Stellungnahme des Bundesrats
Im Vorfeld hatten sich der federführende Rechtsausschuss des Bundesrats, der Ausschuss für Agrarpolitik und Verbraucherschutz, der Ausschuss für Innere Angelegenheiten und der Wirtschaftsausschuss mit dem Gesetzesvorhaben beschäftigt gehabt und dem Bundesrat empfohlen, zum geplanten Gesetz eine Stellungnahme abzugeben.
Der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme vom 28.06.2019 zum Gesetzesentwurf dahingehend positioniert, dass ein fairer Wettbewerb sowohl im Interesse der Verbraucherinnen und Verbraucher als auch der großen Mehrheitsunternehmen, die sich rechtstreu verhalten, liege.
Darüber hinaus erinnert der Bundesrat in seiner Stellungnahme daran, dass Abmahnungen in Deutschland als Mittel der Rechtsdurchsetzung teure und langwierige gerichtliche Auseinandersetzungen vermeiden sollen und – in Ermangelung einer entsprechenden Aufsichtsbehörde zum Verbraucherschutz und zur Sicherung der Lauterkeit im Geschäftsverkehr – der schnellen und kostengünstigen Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen dienen.
Eine Schwächung dieser Rechtsdurchsetzung liegt ebenso wenig im Interesse der Verbraucherinnen und Verbraucher, wie die Möglichkeit missbräuchlicher Abmahnungen, die lediglich dazu dienen, Einnahmen zu Lasten der Verbraucherinnen und Verbraucher zu generieren.
Zudem bittet der Bundesrat im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob für Verbraucherinnen und Verbraucher nicht mehr Transparenz geschaffen werden kann. Dies beispielsweise dadurch, dass bei Abmahnkosten neben der Aufschlüsselung auch die genaue „Berechnung“ der geltend gemachten Zahlungsansprüche anzugeben ist.
Der Bundesrat kritisiert den Gesetzesentwurf, da dieser im geplanten § 8b UWG-E (= Verbot rechtsmissbräuchlicher Abmahnungen) erst dann eine missbräuchliche Geltendmachung vorsehe, wenn anzunehmen ist, dass der Mitbewerber das wirtschaftliche Risiko seines außergerichtlichen uns seines gerichtlichen Vorgehens nicht selbst trägt.
Dies widerspreche dem gesetzgeberischen Zweck, missbräuchliche Abmahnungen wirksam einzudämmen. Die Ausübung der Ansprüche aus § 8 Abs. 1 UWG muss bereits dann unzulässig sein, wenn und sobald der Mitbewerber lediglich außergerichtlich oder null gerichtlich vorgeht und er dabei das Risiko sachlichen und finanziellen Verlustes nicht durchgängig selbst trägt.
Zuletzt bittet der Bundesrat um eine Prüfung im weiteren Gesetzgebungsverfahren, ob die Einschränkung des sog. fliegenden Gerichtsstands auf andere Rechtsgebiete (wie den gewerblichen Rechtsschutz, das Presse- und Äußerungsrecht und das Urheberrecht übertragen werden kann).
Fazit und Ausblick
Mit dem Gesetzesentwurf zur Stärkung des fairen Wettbewerbs steckt sich die Bundesregierung hohe Ziele. Durch die geplanten Maßnahmen sollen vor allem rechtsmissbräuchlicher Abmahnungen reduziert werden. Durch den vorgelegten Gesetzesentwurf würden wohl auch die nicht rechtsmissbräuchlichen, aber massenhaften wettbewerbsrechtlichen Abmahnungen wegen kleinerer (Informationspflicht-) Verstöße eingedämmt werden (können).
Die Stellungnahme des Bundesrats bringt wenig Aufklärung in die teilweise durch den Gesetzesentwurf aufgeworfene Unklarheiten. Es wird weiter zu beobachten bleiben, wie sich der weitere Gesetzgebungsprozess darstellt und welche Änderungen das geplante Gesetz noch erfahren wird. Wir werden über den weiteren Fortgang berichten.
Tipp: Fragen zum Beitrag? Diskutieren Sie hierzu gerne mit uns in der Unternehmergruppe der IT-Recht Kanzlei auf Facebook .
Link kopieren
Als PDF exportieren
Per E-Mail verschicken
Zum Facebook-Account der Kanzlei
Zum Instagram-Account der Kanzlei
Beiträge zum Thema

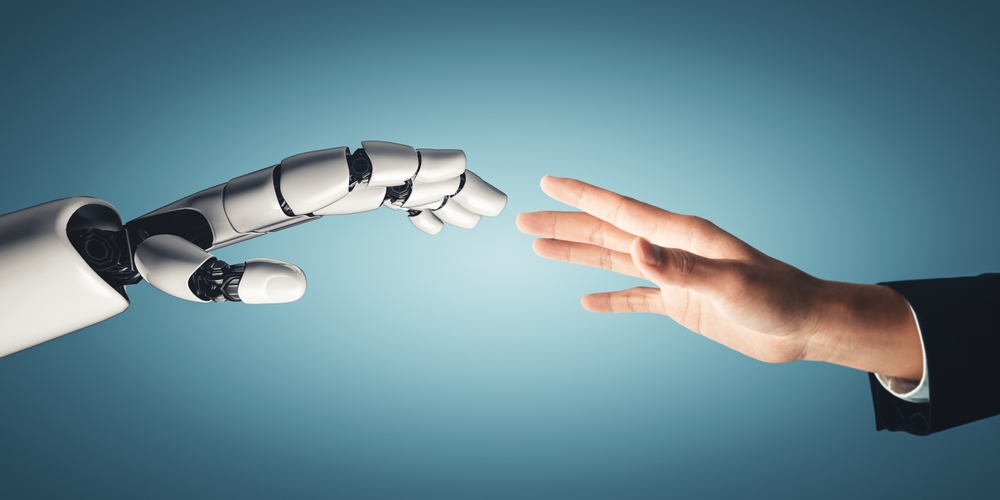







1 Kommentar
KEIN Mensch geht in ein Geschäft und testet 14 Tage lange Hosen, Jacken, TV Geräte, Computer, Sonnenbrillen, Markisen, Schuhe, Drucker, Hemden etc.
"Denn die Vorschriften über den Widerruf von Willenserklärungen, die auf den Abschluss von Fernabsatzverträgen gerichtet sind, dienen lediglich der Kompensation von Gefahren bei bloß virtuellen Begutachtungsmöglichkeiten anhand von Fotos etc. aufgrund der bei Fernabsatzgeschäften fehlenden Möglichkeit die Waren vor Vertragsschluss in Augenschein zu nehmen. Der Verbraucher soll nach dem Willen des Gesetzgebers auch mit online/fernmündlich erworbenen Waren so umgehen dürfen, wie er dies auch in einem Ladengeschäft hätte tun dürfen. Eine zulässige Prüfung sei aber von einer „übermäßigen Nutzung“ abzugrenzen."
Mit einer Widerrufsfrist von 3 Tagen würde der Verbraucher im Onlinehandel nicht benachteiligt.