Und raus bist Du: Zulässigkeit der Kundensperrung wegen übermäßiger Retouren?

Retouren verursachen Aufwand, doch dürfen Händler Verbrauchern wegen hoher Retourenquoten künftige Bestellungen verweigern? Wir gehen dieser Frage im Folgenden nach.
Rechtliche Grundlagen von Retouren im Online-Shop
Wenn Verbraucher bestellte Waren zurückgeben wollen, kommen hierfür verschiedene rechtliche Grundlagen in Betracht.
Den größten Anteil an Retouren machen widerrufsbedingte Rücksendungen aus. Verbrauchern steht für über das Internet geschlossene Verträge insofern nach §§ 312g, 355 BGB grundsätzlich ein Widerrufsrecht zu, das Sie binnen 14 Tagen nach Lieferung der Ware ausüben können. Rechtsfolge des Verbraucherwiderrufs ist die Rückabwicklung des Vertrages und mithin die gegenseitige Rückgewähr erbrachter Leistungen (Warenrückgabe gegen Kaufpreisrückerstattung).
Hintergrund von Retouren kann weiterhin auch ein vom Händler freiwillig gewährtes vertragliches Rückgaberecht (oft als „Stornierungsrecht“ bezeichnet) sein, das der Händler freiwillig und unabhängig vom Widerrufsrecht für Bestellungen einräumt. Freiwillige Rückgaberechte sind im Rechtssinne Bestandteil der Geschäftsbedingungen des Händlers und kommen vor allem dann zum Tragen, wenn der Händler dem Kunden eine längere als die im Widerrufsfall gesetzlich vorgesehene Frist zugestehen will. Händler, die Rückgaben innerhalb eines Zeitraums von mehr als 14 Tagen einräumen, bieten so rechtlich eine Kombination aus gesetzlich zwingendem Widerrufsrecht und freiwilliger längerer Vertragsaufhebungsmöglichkeit an.
Faktisch kommen etwaige freiwillige Rückgaberechte nur zum Tragen, wenn sich das Rückgabeverlangen des Verbrauchers außerhalb der gesetzlichen Widerrufsfrist ereignet oder Waren betrifft, die nach §312g Abs. 2 BGB vom Widerrufsrecht ausgeschlossen sind. Das freiwillige Rückgaberecht kann hierbei, da es ein vom Händler gewährter Zusatz ist, von weitgehenden Bedingungen des Händlers einseitig abhängig gemacht werden.
Einen dritten Fall von Retouren stellen schließlich mangelbedingte Rücksendungen dar. Gemäß §§ 434, 437 BGB stehen Verbrauchern dann, wenn sie eine mangelbehaftete (defekte, beschädigte oder auch andere) Kaufsache erhalten, bestimmte Gewährleistungsrechte zu. Zwar muss dem Händler hier grundsätzlich die Möglichkeit zur Nacherfüllung (Nachlieferung oder Nachbesserung) gegebenen werden. Erfolgt diese aber nicht innerhalb einer vom Verbraucher gesetzten Frist oder ist die Fristsetzung ausnahmsweise entbehrlich (etwa bei strikter Verweigerung des Händlers), kann der Verbraucher gemäß §§ 437 Nr. 2 BGB i.V.m. §§ 323, 346 BGB vom Vertrag zurücktreten. Rechtsfolge des Rücktritts ist wiederum die Rückabwicklung des Vertrages, also die Rückgabe der Kaufsache gegen Rückerstattung des Kaufpreises.
Recht auf Kundenausschluss hängt von Rechtsgrundlage der Retoure ab
Händler, die infolge übermäßiger Retouren eines Verbrauchers und der damit einhergehenden logistischen und wirtschaftlichen Nachteile jeglichen Willen zu künftigen Vertragsschlüssen verloren haben, können Verbraucher nun allerdings nicht anlassunabhängig auf dem Kundenstamm ausschließen.
Vielmehr muss für die rechtliche Zulässigkeit des Ausschlusses und damit einhergehender Maßnahmen wie einer Kontosperrung stets nach dem jeweiligen Rechtsgrund der Retoure differenziert werden.
Grundsätzlich stehen sich hier das virtuelle Hausrecht bzw. das Recht auf Vertragsfreiheit des Händlers und gesetzlich anerkannte Verbraucherschutzbelange gegenüber.
1. Widerrufsbedingte Retouren
Verbraucher, die ihre gesetzlichen Widerrufsrechte intensiv wahrnehmen und in der Folge viele Verträge rückabwickeln lassen, dürfen von Gesetzes wegen nicht Ziel händlerischer Vergeltungsmaßnahmen werden.
Festzuhalten ist nämlich, dass das dem Verbraucher gesetzlich nach §312g BGB zustehende Widerrufsrecht an keine quantitativen Grenzen gebunden ist. Jeder abgeschlossene Fernabsatzvertrag über Waren, der nicht unter die Ausnahmefälle des §312g Abs. 2 BGB fällt, lässt ein eigenes Widerrufsrecht entstehen, das der Online-Händler nicht abbedingen kann. Der Ausschluss von Verbrauchern wegen wiederkehrender Widerrufsbegehren würde mithin die Wahrnehmung gesetzlich etablierter Rechte sanktionieren und kann weder unter Berufung auf primär hausrechtliche Befugnisse noch unter Bezugnahme auf die Vertragsfreiheit zulässig sein.
Derartige Maßnahmen laufen dem gesetzlich vorgesehenen Verbraucherschutz zuwider und sind sogar geeignet, den Verbraucher durch eine gezielte implizite, als Warnung aufgefasste Beeinflussung davon abzuhalten, gegenüber dem sanktionierenden Händler in Zukunft von seinen gesetzlichen Widerrufsrechten Gebrauch zu machen.
Dies gilt im Übrigen erst recht für entsprechende Klauseln in den AGB, die eine derartige Berechtigung vorsehen. Einen Kundenausschluss auf eine derartige vertragliche Vereinbarung zu stützen, muss scheitern, weil die Klauseln als unangemessene Benachteiligungen gem. §307 Abs. 1 und Abs. 2 Nr .1 BGB stets unwirksam sind.
Insofern halten sie den Verbraucher nämlich entgegen den Geboten von Treu und Glauben von der Wahrnehmung seiner Rechte ab und laufen mithin entgegen § 361 Abs. 2 BGB den gesetzlichen Bestimmungen zum Widerrufsrecht durch die Begründung einer widerrufsfeindlichen Vorwirkung zuwider.
zur rechtsmissbräuchlichen Ausübung des Widerrufsrechts
Die Grenze zulässiger Widerrufsbegehren wird dann überschritten, wenn sich der Verbraucher hierbei rechtsmissbräuchlich im Sinne des § 242 BGB verhält. In einem solchen Fall kann ihm das Widerrufsrecht versagt werden und sind dann auch Sanktionen für zukünftige Vertragsschlüsse von Händlerseite zulässig.
Freilich ist ein Rechtsmissbrauch aber nicht bereits wegen einer erhöhten Widerrufsquote anzunehmen. Vielmehr müssen besondere Umstände vorliegen, die darauf schließen lassen, dass der Verbraucher von seinem Widerrufsrecht Gebrauch gemacht hat, um den Händler vorsätzlich zu schädigen oder zu schikanieren. Weil die Beweislast hier grundsätzlich beim Händler liegt, sind Fälle eines tatsächlich vorliegenden Widerrufsrechtsmissbrauchs nur sehr schwer bis kaum begründbar.
2. Gewährleistungsbedingte Retouren
Was für widerrufsbedingte Retouren gilt, ist auslegungsgleich auch für den Kundenausschluss infolge von mängelbedingten Rücksendungen zu folgern.
Erklären Verbraucher auf Basis einer berechtigten Mängelrüge und unter Einhaltung des grundsätzlich geltenden Fristsetzungserfordernisses den Rücktritt vom Vertrag, dürfen Sie für die begründete Wahrnehmung Ihrer Rechte nicht durch Ablehnung zukünftiger Vertragsverhältnisse sanktioniert werden.
Vergeltungsmaßnahmen des Händlers gegenüber Verbrauchern, die berechtigte Gewährleistungsforderungen geltend machen, beschränken gesetzwidrig die nach § 476 Abs. 1 BGB Verbrauchern vorbehaltslos zu gewährenden Gewährleistungsrechte und sind unzulässig.
Bei berechtigten mängelbedingten Retouren muss insofern die händlerische Vertragsfreiheit zurücktreten und Verbraucher dürfen von künftigen Vertragsschlüssen nicht ausgeschlossen werden.
Etwas anderes gilt indes bei wiederholten unberechtigten Reklamationen. Greifen (etwa als Ergebnis einer Mängelprüfung, zu deren Vornahme der Händler berechtigt ist) Gewährleistungsrechte originär nicht ein und sind die Mängelbehauptungen nicht haltbar, können Händler bei wiederholtem Auftreten derartiger Fälle künftige Vertragsschlüsse zurecht verweigern.
3. Retouren aufgrund freiwilligen Rückgaberechts
Anders liegen Fälle, in denen Verbraucher Waren unter Inanspruchnahme eines vom Händler freiwillig gewährten Rückgaberechts zurücksenden.
Weil es sich bei diesem Recht um eine freiwillige Zusatzleistung des Händlers handelt, kann er dieses innerhalb bestimmter rechtlicher Grenzen beliebig ausgestalten und regulieren.
Freiwillige Rückgaberechte bewegen sich außerhalb des Bereichs zwingend zu beachtender Verbraucherschutznormen, sodass bei einer übermäßigen Inanspruchnahme durch Verbraucher der Händlerentschluss, künftig Vertragsschlüsse zu verweigern, von Rechts wegen respektiert werden muss.
Maßnahmen zur Verhinderung neuer Vertragsschlüsse gegenüber Verbrauchern für die Zukunft, die vertragliche Rückgaberechte zu intensiv beanspruchen, sind daher regelmäßig zulässig. Hier überwiegt das Recht auf Vertragsfreiheit des Händlers.
Freilich obliegt es im Streitfall aber dem Händler, die übermäßige Inanspruchnahme auch zu beweisen, um den Vorwurf abzuwenden, es werde der gesetzlich gewährte Verbraucherschutz sanktioniert.
Fazit
Übermäßige Verbraucherretouren sind Händlern häufig ein Dorn im Auge, weil mit Ihnen einerseits ein hoher Rückabwicklungsaufwand und andererseits auch nicht unerhebliche finanziellen Einbußen einhergehen.
Das händlerische Recht zum Ausschluss von Verbrauchern aus dem Kundenstamm, zur Verweigerung künftiger Vertragsverhältnisse oder gar zur Sperrung von Kundenkonten hängt aber stets von der rechtlichen Grundlage für die Retouren ab.
Da Verbraucherwiderrufs- und Gewährleistungsrecht von Gesetzes wegen nicht beschränkt werden dürfen, sind künftige vertragliche Sanktionen für die berechtigte Rechtsausübung (ob übermäßig oder nicht) stets unzulässig.
Dahingegen können Vertragsverhältnisse grundsätzlich verweigert und Unterbindungsmaßnahmen wie Kontosperren grundsätzlich dann gerechtfertigt sein, wenn Verbraucher vom Händler freiwillig eingeräumte Rückgaberechte übermäßig beanspruchen.
Es gilt:
Der Ausschluss von Kunden aufgrund von Retouren ist unzulässig,
- wenn die Retouren in Ausübung des gesetzlichen Widerrufsrechts erfolgen
- wenn die Retouren in Ausübung von bestehenden Gewährleistungsrechten erfolgen
Der Ausschluss von Kunden aufgrund von Retouren kann zulässig sein, wenn den Retouren ein vertragliches Rückgaberecht zugrunde liegt.
Beweisfragen ebenso wie die rechtliche Würdigung dahingehend, ab wann von einem sanktionierbaren „Übermaß“ gesprochen werden kann, gehen dabei aber zu Lasten des Händlers.
Aus diesem Grund sind selbst augenscheinlich gerechtfertigte Ausschlussmaßnahmen stets mit einem Restrisiko behaftet und sollten im Vorfeld zu anderen Maßnahmen in Abwägung gestellt werden.
So könnten einerseits Vorkehrungen getroffen werden, um Rücksendungen von Anfang an entgegen zu wirken (etwa konkrete, eindeutige und anschauliche Produktbeschreibungen oder virtuelle Testmöglichkeiten). Andererseits kann im wiederholten Retourenfall die Entscheidung des Händlers zu Kulanz statt Repression ursprünglich abträgliche Kundenbeziehungen gegebenenfalls nachträglich retten.
Detaillierte weitere Informationen zum hier tangierten Themenbereich des virtuellen Hausrechts im Online-Shop stellt die IT-Recht Kanzlei in diesem Beitrag bereit.
Fragen zum Beitrag? Diskutieren Sie hierzu gerne mit uns in der Unternehmergruppe der IT-Recht Kanzlei auf Facebook.
Link kopieren
Als PDF exportieren
Per E-Mail verschicken
Zum Facebook-Account der Kanzlei
Zum Instagram-Account der Kanzlei

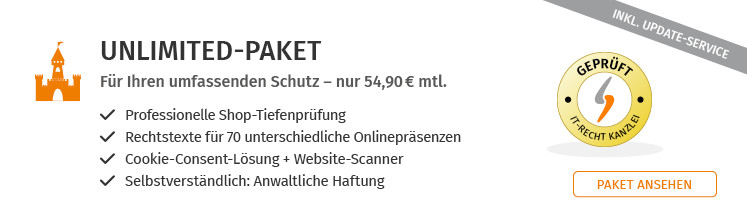




4 Kommentare
Mir ist bisher kein Gesetz bekannt was mich als Händler oder Betreiber verpflichten mit jeden x-beliebigen einen Vertrag zuschließen, denn darauf gibt es keinen Rechtsanspruch.
So kann man auch manuell jede Bestellung prüfen und dann ablehnen und genehmigen, diese widerspricht noch nicht mal der Gesetzgebung seit Dezember 2018 wo mann jeden EU-Bürger Zugang zum Angebot gewähren muss.
Ich würde das jedenfalls so machen.
LG
Demnach kann ich nicht von meinem "Hausrecht" Gebrauch machen und muss jeden unzumutbaren Kunden für alle Zeiten bedienen? So kann man auch einen kleinen Händler in den Ruin treiben bzw. die Hölle auf Erden bereiten.
Ich für meinen Teil lösche jeden Problemkunden aus meiner Kartei bzw. werde den nicht mehr beliefern und Punkt, und dass aus den unterschiedlichsten Gründen. Vorauszahlungen werden umgehend zurück erstattet, das war's, ohne große Erklärungen.
Der Artikel liest sich, als ob man als Händler zwangsweise mit jedem dahergelaufenen Idioten immer und immer wieder einen Vertrag abschließen muss.