In vino veritas: „BIOVERDE“ ungleich „Vinho Verde Portugal“

Das Bundespatentgericht hat entschieden (Beschluss vom 17.02.2012, Az. 26 W (pat) 578/10), dass die deutsche Wortmarke „BIOVERDE“ nicht die international registrierte Wort-/Bildmarke „Vinho Verde Portugal“ verletzt.
Inhaltsverzeichnis
Was war passiert?
Gegen die am 19. Februar 2009 angemeldete Wortmarke „BIOVERDE“ wurde durch die Inhaberin der prioritätsälteren, international registrierten Wort-/Bildmarke „Vinho Verde Portugal“ Widerspruch erhoben. Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) hat den Widerspruch mit Beschluss zurückgewiesen. Zur Begründung hatte sie ausgeführt, dass zwischen den beiden Marken die Gefahr einer Verwechslung im Sinne des § 9 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht bestehe. Gegen diese Entscheidung des DPMA wendete sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde.
Aus der Entscheidung des Gerichts
Die Beschwerde der Widersprechenden war zwar zulässig, in der Sache selbst aber erfolglos. Weiter führt das Gericht aus:
„Der Grad der Markenähnlichkeit ist zu gering, um im Rahmen der gebotenen Gesamtbetrachtung eine Verwechselungsgefahr i. S. d. §§ 125 b, 43 Abs. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen zu begründen. Insbesondere besteht auch nicht die Gefahr einer gedanklichen Verbindung der beiderseitigen Marken i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 letzter Halbsatz MarkenG. “
1. Verwechslungsgefahr
Was ist überhaupt Verwechslungsgefahr im Sinne des Markenrechts? Dazu das Bundespatentgericht:
„Für die Frage der Verwechslungsgefahr [...] ist von dem allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsatz einer Wechselwirkung zwischen allen in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der zu beurteilenden Marken, der Warennähe und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt.“
Eine Marke verfügt immer dann über Kennzeichnungskraft, „wenn sie geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und damit diese Waren oder Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden.“
Um abschließend beurteilen zu können ob sich zwei Marken ähnlich sind und so eine Verwechslungsgefahr im Raum steht, ist eine umfassende Gesamtbetrachtung vorzunehmen:
„Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der Marken im Bild, im Klang oder in der Bedeutung ist auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Waren wirkt. Der Durchschnittsverbraucher nimmt eine Marke regelmäßig als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten.“
Zum konkreten Fall führt das Bundespatentgericht sodann aus:
„Als Ganzes unterscheidet sich die angegriffene Marke von der Widerspruchsmarke wegen der in den beiderseitigen Marken enthaltenen abweichenden Wortbestandteile auffällig. Der in der angegriffenen Marke zusätzlich enthaltene Anfangsbestandteil „Bio“ einerseits und die in der Widerspruchsmarke enthaltenen weiteren Bestandteile „VINHO“ und „PORTUGAL“ andererseits, die sowohl klanglich als auch schriftbildlich zwei Drittel der Widerspruchsmarke ausmachen und in der angegriffenen Marke keine Entsprechung finden, reduzieren die Ähnlichkeit der Marken erheblich. „BIOVERDE“ und „VINHO VERDE PORTUGAL“ vermag der Verkehr klanglich, im Vergleich beider Schriftbilder und begrifflich selbst aus der Erinnerung heraus unabhängig davon deutlich voneinander zu unterscheiden, ob er die Widerspruchsmarke nach portugiesischen oder deutschen Phonetikregeln oder gar als Kombination beider ausspricht“
2. Auch die Gefahr einer gedanklichen Verbindung der beiden Marken im Sinne § 9 Abs. 1 Nr. 2 letzter Halbsatz MarkenG sah das Bundespatentgericht nicht als gegeben an.
Fazit
Die Entscheidung des Bundespatentgerichtes ist vor allem deshalb interessant und erwähnenswert, weil das Gericht markenrechtliche Begriffe vorbildlich definiert und die Voraussetzungen für einen Markenschutz darlegt. Ob nun tatsächlich eine obergerichtliche Entscheidung in Bezug auf die konkreten Marken notwendig gewesen wäre, sei einmal dahingestellt. Es wäre wohl nahezu jedermann möglich gewesen, zu beurteilen, ob sich die Marken unterscheiden.
Fragen zum Beitrag? Diskutieren Sie hierzu gerne mit uns in der Unternehmergruppe der IT-Recht Kanzlei auf Facebook.
Link kopieren
Als PDF exportieren
Per E-Mail verschicken
Zum Facebook-Account der Kanzlei
Zum Instagram-Account der Kanzlei


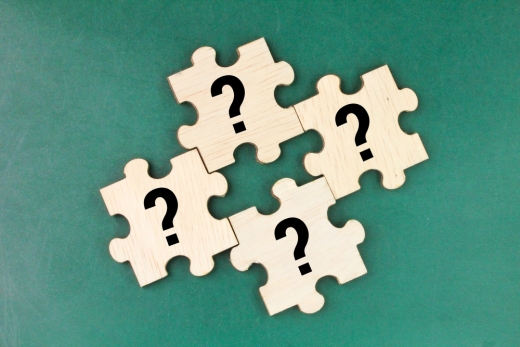
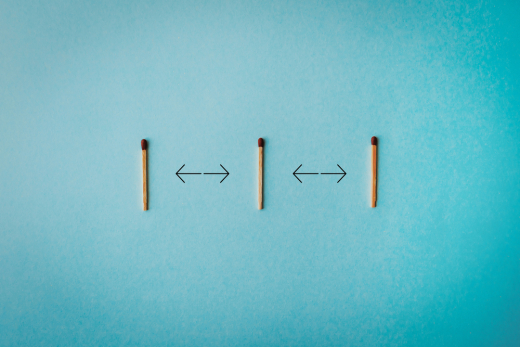


0 Kommentare