Beziehungsstatus: UNBEKANNT - Markenrechtsverletzung bei irreführender Ladenbeschilderung

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist ein zentrales Thema im Markenrecht. Dabei geht es nicht nur darum, ob die sich gegenüberstehenden Zeichen verwechselt werden können, sondern auch darum, ob eine wirtschaftliche Verbindung der hinter den Marken stehenden Unternehmen bei gegenüberstellung der Zeichen suggeriert wird. Die Herkunftsfunktion einer Marke ist etwa dann beeinträchtigt, wenn in der Ladenbeschilderung eines Händlers eine fremde Marke abgebildet ist und damit irrtümlich der Eindruck erweckt werde, dass zwischen dem Händler und dem Markeninhaber vertragliche Beziehungen bestünden (Frankfurt entschied in seinem Urteil vom 21. März 2013, Az.: 6 U 170/12).
Fall
Die Klägerin sah sich in ihren Rechten verletzt, als die Fa. X Elektrogeräte GmbH & Co KG in ihrer Außenwerbung am Ladengeschäft sowohl auf der Leuchtreklame als auch dem oberen Teil des Schaufensters die Klagemarke abbildete. Die Klägerin machte daraufhin Unterlassungsansprüche gem. § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG geltend.
Nachdem das erstinstanzlich zuständige Landgericht Frankfurt der Unterlassungsklage stattgab, legte die Beklagte Berufung ein, sodass der Rechtsstreit den Richtern des Oberlandesgerichts Frankfurt zur Entscheidung vorgelegt wurde.
Entscheidung
Das Berufungsgericht sah jedoch ebenfalls einen Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG für gegeben. Das OLG folgte den Ausführungen des LG Frankfurts insofern, dass die Außenwerbung des Beklagten unzutreffend den Eindruck erwecke, dass zwischen dem Beklagten und dem Inhaber der Klagemarke besondere vertragliche Beziehungen bestünden.
"Für diese Annahme spricht insbesondere, dass die Klägerin ihre Geräte unstreitig in der Vergangenheit ausschließlich über ein Vertretersystem vertrieben hat. Daher weiß der Verkehr, dass „X”-Geräte jedenfalls nicht ohne weiteres über den freien Handel zu beziehen sind. Wenn daher ein Händler die Marke derart prominent herausstellt wie der Beklagte, muss der Eindruck entstehen, dieser Händler habe - anders als andere Elektro-Einzelhändler - irgendeine vertragliche Beziehung mit dem Hersteller."
Das Gericht lehnte diesbezüglich ausdrücklich die Ansicht des Beklagten ab, wonach der Durchschnittsverbraucher auf Grund des vom Hersteller unterhaltenen Vertretersystems davon ausginge, dass die Parteien gerade nicht in vertraglichen Beziehungen stehen müssten.
Auch der Einwand der Beklagten, dass ja im Schaufenster sowie in der Eingangstür des Ladengeschäftes der Hinweis „keine Werksvertretung“ angebracht sei, könne nach Ansicht des Gerichts die Irreführungsgefahr in der vorliegenden Konstellation nicht beseitigen. Lediglich dann, wenn ein solcher Hinweis vom situationsadäquat aufmerksamen Durchschnittsverbraucher nicht übersehen werden könne sobald er die Marke zur Kenntnis nimmt, sei ein solcher Hinweis geeignet einer Irreführungsgefahr entgegen zu wirken.
"Diese Voraussetzung ist ausweislich der Lichtbilder, auf welche das ausgesprochene Verbot Bezug nimmt, im vorliegenden Fall nicht erfüllt; denn während dort der Name „X” deutlich zu erkennen ist, kann der wesentlich kleiner dargestellte Zusatzhinweis allenfalls mit Mühe gelesen werden."
Konsequenz dieser vorliegenden Irreführung des Verkehrs über in Wahrheit nicht bestehende vertragliche Beziehungen des Beklagten mit dem Inhaber der Klagemarke ist gemäß der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes die Beeinträchtigung der Marke. Zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen besteht weiter Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Außerdem greifen wegen der genannten Irreführungsgefahr auch die Schutzschranken der §§ 23, 24 MarkenG nicht ein.
Im Übrigen könne sich der Beklagte im Falle des Unterlassungsanspruches auch nicht auf die Einrede der Verwirkung gem. § 242 BGB berufen, welche als Folge hätte, dass der Markeninhaber seine Rechte aus der Marke im Hinblick auf bereits begangene oder noch andauernde Rechtsverletzungen nicht mehr durchsetzen könnte. Ein „Freibrief für künftige Schutzrechtsverletzungen“ sei damit in der Regel jedoch nicht verbunden.
Ein ausnahmsweises Durchgreifen der Einrede der Verwirkung setzt jedoch voraus, dass der Markenrechtsverletzer infolge der über längere Zeit hingenommenen Markenverletzung einen wertvollen Besitzstand erlangt hat, den er durch die Befolgung des Unterlassungsbegehrens verlieren würde.
"Auf einen solchen wertvollen Besitzstand kann sich der Beklagte jedoch nicht mit Erfolg berufen. Denn der Beklagte wird durch den Unterlassungsausspruch nicht etwa daran gehindert, den Vertrieb von gebrauchten „X”- Originalgeräten sowie von Ersatzteilen hierfür fortzusetzen; er wird lediglich gezwungen, seine bisherige Werbung so - etwa durch einen deutlicheren Hinweis auf die fehlende Vertragshändlereigenschaft - zu ändern, dass die beschriebene Irreführungsgefahr vermieden wird."
Anders sah das Gericht dies jedoch im Falle des grundsätzlich gegebenen Auskunfts- und Schadensersatzfeststellungsanspruches. Hier ließen die Richter des OLG die Einrede der Verwirkung zu, da für die Verwirkung des Schadensersatzanspruchs wegen Verletzung einer Marke die Beeinträchtigung eines wertvollen Besitzstandes keine Voraussetzung sei.
"Unter diesen Umständen reichten die genannten Umstands- und Zeitmomente aus, um beim Beklagten das schutzwürdige Vertrauen darauf begründen, dass die Klägerin wegen einer etwa weiterhin gegebenen Markenverletzung durch seine Ladenbeschilderung jedenfalls keine Schadensersatzansprüche - die nach der Berechnungsmethode der Lizenzanalogie eine beträchtliche Höhe erreichen können - mehr geltend machen würde."
Der zu Gunsten des Beklagten begründete Vertrauenstatbestand ende allerdings, so das Gericht, mit der erneuten Abmahnung der Klägerin. Diese habe nämlich zur Folge, dass sich der Beklagte dann wieder auf das Risiko einzurichten habe, für den Folgezeitraum im Falle einer Markenrechtsverletzung auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden zu können. Diesbezügliche könne dem Beklagten jedoch eine gewisse Prüfungsfrist zugebilligt werden.
Fazit
Für die Einrede der Verwirkung gegen einen Schadensersatzanspruch reicht also grundsätzlich aus, dass beim Verletzer unter Berücksichtigung der Gesamtumstände, insbesondere auf Grund des Verhaltens des Markeninhabers und des eingetretenen Zeitablaufs, das schutzwürdige Vertrauen darauf entstehen konnte, der Markeninhaber werde nach so langer Zeit keine Schadensersatzansprüche wegen Verletzung der Klagemarke mehr geltend machen.
Aber Aufgepasst! Auf Seiten des Markeninhabers setzt die Verwirkung nicht unbedingt die Kenntnis von der Markenverletzung voraus. Es reicht vielmehr aus, dass die Verletzung einer Marktbeobachtungspflicht gegeben ist, wobei das Bestehen einer solchen Pflicht von den Gesamtumständen abhängt. Ob eine solche Marktbeobachtungspflicht im Einzelfall besteht, sollte daher zu jeder Zeit äußerst sorgfältig geprüft werden. Wie der vorliegende Fall verdeutlicht, kann ein Irrtum auf dieser Ebene im Hinblick auf spätere Schadensersatzansprüche besonders verheerende Auswirkungen haben.
Fragen zum Beitrag? Diskutieren Sie hierzu gerne mit uns in der Unternehmergruppe der IT-Recht Kanzlei auf Facebook.
Link kopieren
Als PDF exportieren
Per E-Mail verschicken
Zum Facebook-Account der Kanzlei
Zum Instagram-Account der Kanzlei

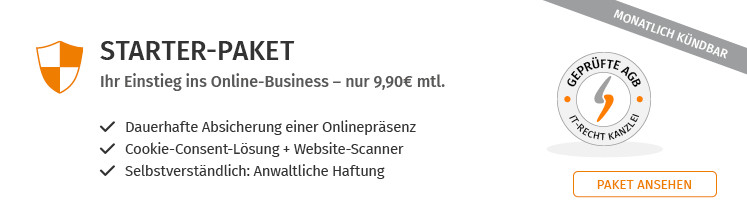
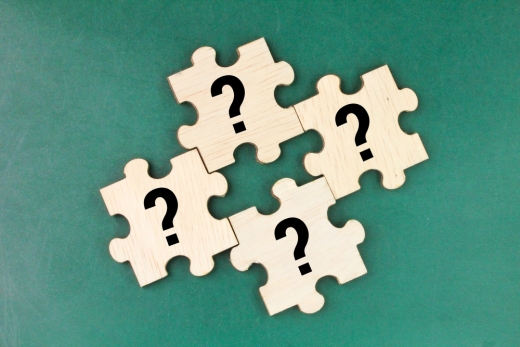
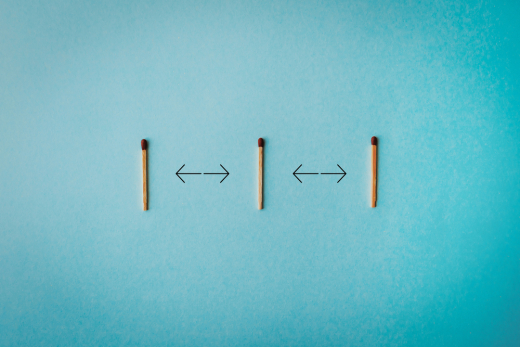


0 Kommentare