Nacherfüllung im Handel: Rechte & Pflichten des Händlers kurz erklärt

Kunden verlangen bei Mängeln häufig sofort ein neues Produkt – doch nicht immer müssen Händler dem nachgeben. Wann darf eine Nachlieferung verweigert werden und was gilt zu Kosten und Beweislast?
Inhaltsverzeichnis
- Nacherfüllung: Das sollten Händler wissen
- Grenzen: Wann darf der Händler die gewählte Art der Nacherfüllung verweigern?
- Umfang der Ersatzlieferung: Muss der Händler Ein- und Ausbaukosten tragen?
- Wie lange hat der Käufer das (Wahl)Recht zur Nacherfüllung?
- Kann der Käufer Kosten für die Nacherfüllung ersetzt verlangen?
- Muss der Käufer die mangelhafte Sache herausgeben?
- Gilt das Wahlrecht auch bei Verträgen zwischen Unternehmern?
Nacherfüllung: Das sollten Händler wissen
Liefert der Händler eine mangelhafte Ware, wandelt sich der ursprüngliche Erfüllungsanspruch des Käufers in einen Anspruch auf Nacherfüllung.
Das Gesetz gibt dem Händler damit die Möglichkeit, die geschuldete Leistung trotz Mangels ordnungsgemäß nachzuholen – denn eine mangelhafte Lieferung stellt gerade keine ordnungsgemäße Erfüllung des Kaufvertrags dar.
1. Welche Optionen hat der Käufer?
Der Käufer hat ein gesetzliches Wahlrecht und kann selbst entscheiden, auf welche Weise der Mangel beseitigt werden soll (§ 439 Abs. 1 BGB) .
Zur Auswahl stehen dabei:
- die Nachbesserung, also die Reparatur oder der Austausch defekter Teile, oder
- die Lieferung einer neuen, mangelfreien Ware (Ersatzlieferung).
Ein Verschulden des Händlers ist hierfür nicht erforderlich – der Anspruch entsteht allein dadurch, dass ein Mangel vorliegt.
Der Händler hat das Recht, die beanstandete Ware auf Mängel zu untersuchen. Dazu kann vom Käufer die Einsendung der vermeintlich mangelhaften Ware verlangt werden.
Macht der Händler bei einer Mängelrüge des Käufers von seinem Recht auf Mängelprüfung Gebrauch, hängt die Verantwortlichkeit für die Einsendekosten der Ware davon ab, ob sich die Kaufsache bei der Prüfung als tatsächlich mangelhaft erweist oder nicht.
Ergibt die Prüfung einen Sachmangel und damit die Begründetheit des Käufervorwurfs, muss der Händler gemäß §439 Abs. 2 BGB für die Einsendekosten aufkommen. Ist das Gegenteil der Fall, obliegen diese dem Käufer, wobei dies für Verbraucher nur dann gilt, wenn diese bei der Einsendung der Ware erkannt haben oder hätten erkennen müssen, dass kein Mangel vorliegt.
Allerdings ist der Händler beim Verbrauchsgüterkauf gemäß § 475 Abs. 4 BGB stets verpflichtet, die Einsendekosten als Vorschuss zu übernehmen, und kann diese nicht anfänglich und mit der Bereitschaft einer eventuellen späteren Rückerstattung auf den Käufer abwälzen. Vielmehr muss der Händler vorgeschossene Einsendekosten im Falle einer unbegründeten Mängelrüge nachträglich vom Käufer zurückzufordern.
2. Wann besteht ein Anspruch auf Nacherfüllung?
Voraussetzung ist ein Mangel, der bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorhanden war.
Bei Verbrauchern greift hierbei die gesetzliche Vermutung des § 477 BGB: Zeigt sich der Mangel innerhalb der ersten zwölf Monate, wird zugunsten des Käufers angenommen, dass er schon bei Übergabe vorhanden war.
Entsteht der Mangel hingegen erst nach dem Gefahrübergang und war er zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs auch noch nicht in der Ware angelegt, fällt er nicht mehr in den Verantwortungsbereich des Verkäufers.
Grundsätzlich geht die Gefahr mit der Übergabe der Ware auf den Käufer über (§ 446 BGB) . Im Versandhandel gilt jedoch eine wichtige Besonderheit: Hier trägt der Verbraucher das Risiko erst ab dem Zeitpunkt, an dem er die Ware tatsächlich in Empfang nimmt (§ 475 Abs. 2 BGB) .
3. Keine Einschränkung per AGB
Das Wahlrecht des Verbrauchers darf nicht durch AGB beschnitten werden. Zudem hat die Nacherfüllung immer Vorrang vor Minderung, Rücktritt oder Schadensersatz.
Erst wenn der Händler die Möglichkeit zur Nacherfüllung hatte und diese scheitert oder ernsthaft und endgültig verweigert wird, können weitere Rechte des Käufers greifen.
Grenzen: Wann darf der Händler die gewählte Art der Nacherfüllung verweigern?
Grundsätzlich darf der Verbraucher frei wählen, ob er eine Reparatur oder eine neue Ware verlangt. Der Händler kann die gewählte Art der Nacherfüllung jedoch verweigern, wenn sie im Vergleich zur anderen Art unverhältnismäßig hohe Kosten verursacht (§ 439 Abs. 4 BGB) .
Dies gilt sowohl für die Ersatzlieferung, wenn eine Reparatur deutlich günstiger wäre, als auch umgekehrt für die Nachbesserung, wenn eine Reparatur im Verhältnis zur Ersatzlieferung unverhältnismäßig teuer wäre.
Liegt eine solche Unverhältnismäßigkeit vor, beschränkt sich der Anspruch des Kunden automatisch auf die jeweils andere Art der Nacherfüllung.
- Bei einem Neuwagen reißt der Keilriemen. Der Austausch ist schnell und kostengünstig möglich. Die Forderung nach einem komplett neuen Fahrzeug wäre daher unverhältnismäßig.
- Ein günstiger Kopfhörer (Wert ca. 5 €) hat einen Kabelbruch. Eine Reparatur wäre aufwändiger und teurer als die Lieferung eines neuen Exemplars. In diesem Fall kann der Händler die Reparatur verweigern.
Umfang der Ersatzlieferung: Muss der Händler Ein- und Ausbaukosten tragen?
Oft ist der Austausch defekter Teile mit erheblichem Aufwand verbunden, insbesondere wenn die Sache bereits eingebaut wurde.
Ein Verbraucher kauft Bodenfliesen und lässt sie verlegen. Später zeigen sich Materialfehler, die erst im verlegten Zustand sichtbar werden (z. B. Schattierungen). Eine Reparatur ist ausgeschlossen, es müssen neue Fliesen geliefert und verlegt werden.
Im Rahmen der Nacherfüllung ist der Verkäufer verpflichtet, die mangelhafte Sache auszubauen und die neue Sache einzubauen oder jedenfalls die dafür erforderlichen Kosten zu übernehmen (§ 439 Abs. 3 BGB) .
Diese Regelung basiert ursprünglich auf der Rechtsprechung des EuGH und ist mittlerweile ausdrücklich im deutschen Gesetz verankert. Der Käufer darf für Ein- und Ausbau nicht zur Kasse gebeten werden, es sei denn, ihm war der Mangel zum Zeitpunkt des Einbaus bekannt.
Wie lange hat der Käufer das (Wahl)Recht zur Nacherfüllung?
Gewährleistungsrechte – und damit auch der Anspruch auf Nacherfüllung – verjähren bei beweglichen Sachen grundsätzlich nach zwei Jahren (§ 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB) . Die Frist beginnt mit der Übergabe der Sache.
Eine wichtige Besonderheit betrifft beim Verbrauchsgüterkauf die Beweislastumkehr nach § 477 BGB:
Zeigt sich innerhalb von zwölf Monaten nach Gefahrübergang ein Mangel, wird gesetzlich vermutet, dass dieser bereits bei Übergabe vorhanden war. Der Verbraucher muss in diesem Zeitraum also nicht nachweisen, dass der Defekt von Anfang an bestand.
Nach Ablauf der zwölf Monate kehrt sich die Beweislast um – dann muss der Käufer darlegen und beweisen, dass der Mangel nicht erst später entstanden ist.
(Ausnahme: Beim Kauf lebender Tiere gilt die Vermutung nur für sechs Monate.)
Kann der Käufer Kosten für die Nacherfüllung ersetzt verlangen?
Der Verkäufer hat die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen zu tragen. Der Käufer soll nach dem Willen des Gesetzgebers von solchen Kosten freigehalten werden.
Welche Kosten muss der Händler tragen?
Der Verkäufer trägt alle erforderlichen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Nacherfüllung (§ 439 Abs.2 und 3 BGB) .
Dazu zählen insbesondere:
- Transport- und Wegekosten: Muss der Kunde Ware verschicken oder persönlich zur Reparatur anliefern, sind ihm diese Kosten (z.B. Portokosten, Benzin, Tickets) zu erstatten.
- Arbeits- und Materialkosten
Muss ein Käufer den defekten Artikel selbst zum Laden oder zur Werkstatt bringen, sind die dafür anfallenden Fahrtkosten (Benzin, ÖPNV) vom Händler zu ersetzen.
2. Die Vorschusspflicht: Eine wichtige Händlerfalle
Beim Verbrauchsgüterkauf kann auch die Vorschusspflicht nach § 475 Abs. 4 BGB relevant werden:
Demnach hat der Verbraucher das Recht, die voraussichtlichen Kosten – etwa für den Versand der Ware oder die Fahrt zur Reparatur – bereits vorab als Vorschuss vom Händler zu verlangen.
Der Verbraucher muss also nicht in Vorleistung treten. Der Händler darf jedoch Nachweise über die voraussichtlichen Kosten verlangen, sofern dies die Vorschussgewährung nicht verzögert.
Zwingendes Recht
Die Pflicht zur Kostentragung und gegebenenfalls zur Leistung eines Vorschusses ist zwingendes Verbraucherrecht. Dieses kann durch AGB nicht wirksam ausgeschlossen werden.
Muss der Käufer die mangelhafte Sache herausgeben?
Wird die Nacherfüllung durch die Lieferung einer neuen, mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) erbracht, hat der Käufer den ursprünglichen mangelhaften Artikel an den Verkäufer herauszugeben (§ 439 Abs. 6 BGB) .
Auch wenn die mangelhafte Sache über einen längeren Zeitraum durch den Käufer genutzt wurde, darf beim Verbrauchsgüterkauf kein Ersatz für die gezogenen Nutzungen (Gebrauchsvorteile) vom Verbraucher verlangt werden (§ 475 Abs. 3 Satz 1 BGB) .
Beispiel: Ein Fahrrad wird nach 5 Monaten wegen eines Rahmenschadens gegen ein neues getauscht. Der Verbraucher muss das alte Rad zurückgeben, muss aber nichts dafür zahlen, dass er es 5 Monate lang gefahren hat.
Gilt das Wahlrecht auch bei Verträgen zwischen Unternehmern?
Die strengen Verbraucherschutzregeln, die der Gesetzgeber für Verträge zwischen Unternehmen und Endkunden (B2C) vorsieht, gelten beim reinen Unternehmerkauf (B2B) nur eingeschränkt:
- Ein Unternehmer hat grundsätzlich kein Wahlrecht bezüglich der Art der Nacherfüllung (Nachbesserung oder Ersatzlieferung), sofern vertraglich keine abweichende Regelungen getroffen wurde.
- Die einjährige Beweislastumkehr zugunsten des Käufers – die nur beim Verbrauchsgüterkauf gilt – findet hier keine Anwendung.
Ein Händler, der die Ware an einen Verbraucher weiterverkauft, genießt jedoch Schutz in der Lieferkette (Unternehmerregress):
- Muss der Händler gegenüber seinem Käufer wegen eines Mangels der Kaufsache nacherfüllen, kann er unter bestimmten Voraussetzungen bei seinem Lieferanten Regress nehmen (§ 445a BGB) .
- Der Händler muss dem Lieferanten dabei keine Frist zur Nacherfüllung setzen, wenn er selbst vom Käufer in Anspruch genommen wurde (§ 445a Abs. 2 BGB) .
- Der Händler kann die Aufwendungen (z. B. Transport- oder Materialkosten), die er seinem Käufer erstatten musste, grundsätzlich vom Lieferanten zurückfordern.
Fragen zum Beitrag? Diskutieren Sie hierzu gerne mit uns in der Unternehmergruppe der IT-Recht Kanzlei auf Facebook.
Link kopieren
Als PDF exportieren
Per E-Mail verschicken
Zum Facebook-Account der Kanzlei
Zum Instagram-Account der Kanzlei

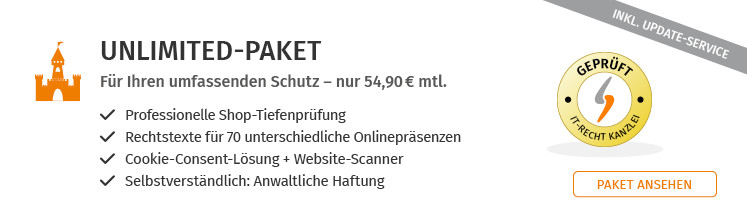
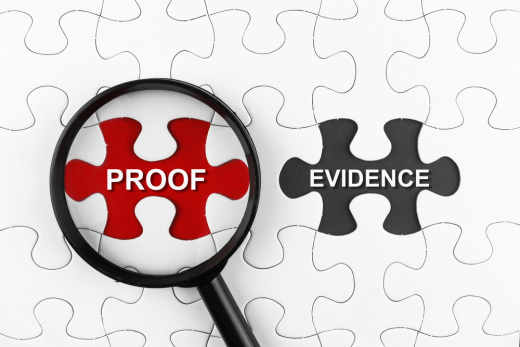

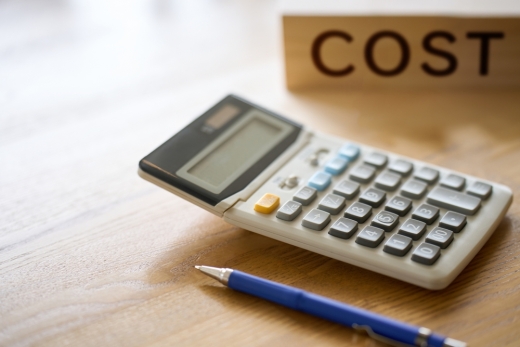
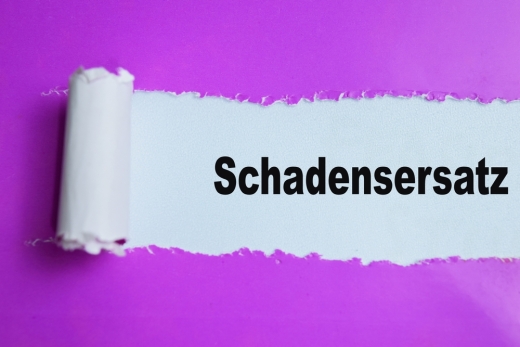
4 Kommentare
Nach Fristsetzung teilt der Händler nunmehr mit, dass ein Austausch der Möbel nicht möglich ist, weil die Modelle nicht mehr hergestellt werden. Alternative Modelle mit gleichen Maßen sind ebenfalls nicht mehr im Angebot. Eine Reparatur sei , wenn überhaupt, nur eingeschränkt möglich, weil das Furnier beschädigt ist. Eine eventuelle, optische Beeinträchtigung müsse insofern hingenommen werden.
Muss ich eine improvisierte Reparatur hinnehmen? Welche Rechte verbleiben mir als Verbraucher, wenn ein Austausch der beschädigten Schränke nicht möglich ist? Geld zurück ist keine gute Möglichkeit, weil ich dann den Stress mit Neubeschaffung und Einbau habe.
Danke.
Der Händler der SO handelt, handelt bereits GROB FAHRLÄSSIG! Das passiert nur den Händlern, die Gesetze ausreizen und meinen schlauer zu sein, als andere Verkäufer. Wenn dieser Händler ein vom Hersteller überholtes Gebrauchtgerät beziehen kann, dann ist er auf der sicheren Seite und erfüllt - egal wie alt dieses identische Gerät ist - diese Nachbesserung.