Print on Demand: Ratgeber zu rechtlichen Besonderheiten

Print-on-Demand-Händler sehen sich beim Outsourcing von Indruckgabe und Lieferung mit vertraglichen Besonderheiten und Anforderungen aus diversen Rechtsgebieten konfrontiert. Was im Online-Print-on-Demand-Geschäft rechtlich zu beachten ist, zeigt dieser Beitrag.
Inhaltsverzeichnis
- Print-on-Demand: Kernaspekte des Geschäftsmodells
- Vor- und Nachteile von Print-on-Demand
- 1. Vorteile des Print-on-Demand
- 2. Nachteile des Print-on-Demand
- Vertragsrechtliche Probleme und Besonderheiten
- 1. Vertragliche Probleme im Verhältnis zum PoD-Dienstleister
- 2. Vertragliche Haftung gegenüber dem Käufer
- 3. Probleme im Zusammenhang mit dem gesetzlichen Widerrufsrecht für Verbraucher
- Ausschluss des Widerrufsrechts für Print-on-Demand-Produkte?
- Datenschutzrechtliche Aspekte
- 1. Erforderlichkeitsschranke für Datenübermittlungen
- 2. Gefahr rechtswidriger Drittstaatentransfers
- 3. Vertrag über die Auftragsdatenverarbeitung (AV-Vertrag)?
- 4. Belehrung in der Datenschutzerklärung
- Wahrung von Urheber- und Markenrechten
- 1. Urheberrecht
- 2. Markenrecht
- 3. Customer Content
- Weitergehende Rechtspflichten für die Verkehrsfähigkeit von Print-on-Demand-Produkten
- 1. Verpackungsrechtliche Pflichten
- 2. Pflichten nach dem Produktsicherheitsrecht
- 3. Produktspezifische Kennzeichnungs- und Informationspflichten
- Fazit
Print-on-Demand: Kernaspekte des Geschäftsmodells
Als „Print-on-Demand“ (PoD) gelten Geschäftsmodelle des Angebots bedruckter Produkte (meist aus dem Textil- und Keramikbereich), die durch Auswählbarkeit einer Vielzahl von Motiven personalisierbar sind.
Während der Händler die Motive, Designs und Personalisierungsoptionen auswählt und über seinen Verkaufskanal so die Vielfältigkeit seines Angebots definiert, sind Lagerhaltung, Produktion sowie Druck und Versand auf einen oder mehrere externe Print-on-Demand-Dienstleister ausgelagert.
Der Händler kann hierbei selbst kreierte Gestaltungen oder Designs aus fremder Urheberschaft zur Auswahl stellen, seinen Kunden aber auch ermöglichen, eigene Entwürfe für die Bedruckung von Produkten zu übermitteln.
Aufträge werden „on demand“, also nur auf die Aufgabe einer konkreten Bestellung hin, abgewickelt, indem die Auswahl des Kunden an den Dienstleister übermittelt und dieser sodann mit Indruckgabe und Versand beauftragt wird.
Auf eine eigene Bevorratung mit Rohlingen und auf logistische Organisation kann daher grundsätzlich verzichtet werden.
Der Kunde bekommt von alldem in der Regel gar nichts mit: Er bestellt ganz normal im Webshop des Online-Händlers, schließt den Kaufvertrag also mit dem Online-Händler und erhält schließlich die Ware. Dass diese von einem anderen Unternehmen produziert und verschickt worden ist, kümmert den Käufer in der Regel nicht.
Vor- und Nachteile von Print-on-Demand
Für Online-Händler bietet Print-on-Demand sowohl Vor- als auch Nachteile.
1. Vorteile des Print-on-Demand
Vorteil für Webshop-Betreiber ist zum einen die im Vergleich zur herkömmlichen Verkaufsweise geringere Kapitalbindung, da die Ware nicht selbst im Vorhinein eingekauft werden muss, sondern erst dann vom PoD-Dienstleister per Kaufvertrag erworben wird, wenn sie seinerseits vom Kunden im Webshop bestellt worden ist.
Zudem benötigen Online-Händler beim Print-on-Demand-Verkauf keine oder jedenfalls nur geringere Lagerkapazitäten und es entfallen Zeit und Aufwand für die Versandabwicklung. Schließlich lassen sich Erweiterungen des Sortiments risikoärmer stemmen, weil es keine Ladenhüter gibt, auf denen die Online-Händler sitzen bleiben könnten.
2. Nachteile des Print-on-Demand
Die Nachteile des Print-on-Demand sind jedoch nicht zu vernachlässigen:
- Immerhin geben Online-Händler dadurch einen Teil ihres Geschäfts aus der Hand und haben somit keine oder nur noch geringe Kontrolle über die Qualität der fremdversandten Ware und des Versandes an sich, insbesondere in Bezug auf Versanddauer und -kosten.
- Freilich sind bei Print-on-Demand zudem die Gewinnmargen minimiert, weil sich die Dienstleister ihre Druck-, Verpackungs- und Versandleistungen (gut) bezahlen lässt.
- Schließlich sind – je nach Absprache mit dem PoD-Dienstleister – Retouren, seien es mangelbedingte Reklamationen oder Rücksendungen nach Verbraucherwiderrufen, nicht unproblematisch: Diese erfolgen zumeist an den Händler, der diese dann bearbeiten, ggf. einlagern, wiederverkaufen und dann selbstständig versenden muss, wenn er keine anderslautende Vereinbarung mit seinem PoD-Dienstleister getroffen hat. Letztlich kommen PoD-Händler um eigene Logistik also nicht gänzlich herum.
Vertragsrechtliche Probleme und Besonderheiten
Weil im Print-on-Demand-Modell einerseits unmittelbar Kaufverträge mit Endkunden geschlossen, andererseits aber vertragliche Bindungen auch zum jeweiligen PoD-Dienstleister eingegangen werden, sind Händler gehalten, ein vertraglich duales System einzurichten und zu erhalten.
Hieraus können sich insofern Probleme ergeben, als der Händler dem Käufer gegenüber als Vertragspartner vollständig haftet und für etwaige Fehler des PoD-Dienstleisters nur im Innenverhältnis zu diesem einen Ausgleich verlangen kann.
Risikoanfälligkeiten ergeben sich insofern in Bezug auf die Ausgestaltung des Rahmenvertrags mit dem PoD-Dienstleister einerseits und in Bezug auf gesetzliche Verbraucherrechte aus den Kaufverträgen andererseits.
1. Vertragliche Probleme im Verhältnis zum PoD-Dienstleister
Wer PoD-Ware vertreiben möchte, muss sich hierfür grundsätzlichen den Geschäftsbedingungen des ausgewählten Dienstleisters unterwerfen, sei es über einen entsprechenden Rahmenvertrag oder deshalb, weil nach Bestelleingang im Online-Bestellsystem des Dienstleisters ein entsprechender Auftrag hinterlegt wird.
Für besondere Relevanz für den Händler sind dabei Fragen nach der vertraglichen Risikoverteilung in Bezug auf die Bedruckung und Produktion, den Versand und die Haftung für Produktfehler.
In der Praxis besteht hierbei nicht selten das Problem, dass der PoD-Partner im Ausland, oft sogar im Nicht-EU-Ausland sitzt, was zu Unklarheiten darüber führen kann, nach welcher Rechtsordnung entsprechende Verträge abgeschlossen werden und wo und nach welchem Recht im Falle von Streitigkeiten Ansprüche gegen den Vertragspartner durchzusetzen sind.
2. Vertragliche Haftung gegenüber dem Käufer
Bei Print-on-Demand hängt die Haftbarkeit des Händlers im Verhältnis zum Kunden von der Leistung des PoD-Dienstleisters ab, auf die er keinen direkten Einfluss nehmen kann.
Immerhin haftet der Händler dem Kunden gegenüber für die ordnungsgemäße Durchführung des geschlossenen Kaufvertrages ebenso wie für die vertraglich vereinbarte oder vorausgesetzte Produktbeschaffenheit gemäß § 433 Abs. 1 BGB.
Erhält der Kunde vom PoD-Dienstleister also eine mangelhafte Ware oder wird diese nicht innerhalb der vom Händler in Aussicht gestellten Lieferzeit zugestellt, so kann sich der Kunde mit seinen Ansprüchen direkt an seinen Vertragspartner, also den Händler halten.
Dies gilt umso mehr, als der PoD-Dienstleister im Rechtssinne bei der Vertragsabwicklung als Erfüllungsgehilfe des Händlers auftritt und der Händler für ein Verschulden des PoD-Dienstleisters daher gemäß § 278 BGB dem Kunden gegenüber wie für eigenes Verschulden haftet.
Dem Händler bleiben dann zwar noch Regressansprüche gegen den PoD-Dienstleister. Deren Durchsetzung bereitet aber gerade bei Verträgen mit Unternehmen im Nicht-EU-Ausland erhebliche Schwierigkeiten.
3. Probleme im Zusammenhang mit dem gesetzlichen Widerrufsrecht für Verbraucher
Ein weiteres Problem ergibt sich im Hinblick auf das gesetzliche Widerrufsrecht für Verbraucher bei Fernabsatzverträgen.
a. Eigene Lagerkapazitäten oder abweichende Rücksendeadresse
Grundsätzlich muss der Händler die Ware, die der Kunde im Rahmen des gesetzlichen Widerrufsrechts zurücksendet, selbst zurücknehmen. Dies könnte den Händler jedoch vor größere logistische Probleme stellen, wenn er nicht selbst über ausreichende Lagerkapazitäten verfügt.
Daher werden in der Praxis zwar häufig Vereinbarungen zwischen Händler und PoD-Dienstleister getroffen, nach denen letzterer auch das Retouren-Management für den Händler übernehmen soll.
Über eine sich daraus ergebende abweichende Rücksendeadresse muss der Händler vollständig und transparent in seiner Widerrufsbelehrung informieren.
Zumutbar ist die Vorgabe einer abweichenden Rücksendeadresse im Widerrufsfall allerdings nur dann, wenn dem Verbraucher durch die Rücksendung an eine andere Adresse als den Sitz des Händlers keine zusätzlichen Kosten entstehen, was insbesondere die Auflage zu kostenpflichtigen widerrufsbedingten Rücksendungen an PoD-Adressen im Ausland unzulässig erscheinen lässt.
b. Folgeproblem bei Einsatz mehrerer PoD-Dienstleister
Bedient sich ein Händler für die Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten nicht nur eines, sondern mehrerer PoD-Dienstleister je nach Produktart, muss eine Auslagerung von widerrufsbedingten Rücksendungen an diese aber gänzlich ausscheiden.
Der Händler hätte nämlich keine Möglichkeit, über die konkret einschlägige Rücksendeadresse transparent zu informieren. Maßgebliches Medium für Informationen über widerrufsbedingte Rücksendungen ist die Widerrufsbelehrung. Würde der Händler darin aber die Sitze mehrerer PoD-Dienstleister als alternative Adressen für die Rücksendung definieren, wüsste der Kunde nie, an welche Anschrift er die konkret erworbene Ware tatsächlich retournieren muss.
Folglich wäre die Widerrufsbelehrung des Händlers in Bezug auf die Rücksenderegelung mehrdeutig, unzureichend und aufgrund des Irreführungspotenzials gegenüber Verbrauchern sogar eigenständig abmahnbar.
Um die Vorgaben der Pflichtinformationen im Zusammenhang mit dem gesetzlichen Widerruf zu wahren, ist es bei Kooperation mit mehreren PoD-Dienstleistern daher unabdinglich, eine zentrale Rücksendeadresse (im Zweifel die eigene) zu definieren und in der Widerrufsbelehrung zu benennen.
Tipp:
Die Widerrufsbelehrungen der IT-Recht Kanzlei, die als Teil spezieller Rechtstexte-Schutzpakete mit vollständiger Eignung für PoD-Modelle angeboten werden, sehen die Möglichkeit vor, rechtskonform alternative ausschließliche Rücksendeadressen zu definieren.
Ausschluss des Widerrufsrechts für Print-on-Demand-Produkte?
Unter PoD-Händlern hält sich das Gerücht eines besonderen Privilegs im Zusammenhang mit dem gesetzlichen Verbraucherwiderrufsrecht, das Verbraucher bei Online-Verträgen zur einseitigen vertraglichen Rückabwicklung grundsätzlich innerhalb von 14 Tagen ab der Lieferung befähigt.
Weil das Verbraucherwiderrufsrecht nach § 312g Abs. 2 Nr. 1 BGB nicht für Verträge zur Lieferung von Waren gilt, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind, wird angenommen, PoD-Produkte seien grundsätzlich vom Widerrufsrecht ausgeschlossen.
Dies ist allerdings ein trügerischer Fehlschluss.
Der genannte Ausschlussgrund greift nach ständiger Rechtsprechung nämlich nur ein, wenn ein Produkt so nach den spezifischen Maßgaben eines Verbrauchers angefertigt wurde, dass es im Falle einer hypothetischen Rücknahme gar nicht oder nur mit großer finanzieller Einbuße an einen Dritten weiterverkauft werden könnte.
Für Print-On-Demand-Produkte ergibt sich daraus folgende Konsequenz:
- Ist das Produkt nur nach einer vom Händler vorgegebenen Motivauswahl und nach Farbe und Größe personalisierbar, besteht ein Verbraucherwiderrufsrecht. Es ist nämlich nicht ausgeschlossen, dass im Falle einer hypothetischen Rücknahme ein anderer Kunde dieselbe Auswahl trifft und das Produkt damit erneut verkauft werden kann (s. auch LG Verden, Urteil vom 03.07.2023 - Az.:10 O 13/23).
- Nur dann, wenn das Produkt mit einem persönlichen, vom Kunden eigens übermittelten Motiv bedruckt wird, kann ein Widerrufsrecht aufgrund einer Maßanfertigung ausgeschlossen werden.
Datenschutzrechtliche Aspekte
Print-on-Demand-Aktivitäten sind zwangsweise von datenschutzrechtlicher Relevanz, weil die beim Händler erhobenen Käuferdaten zu Vertragsabwicklungszwecken an den PoD-Dienstleister übermittelt werden müssen. Immerhin ist dieser ja für die Ausführung der Bestellung verantwortlich.
1. Erforderlichkeitsschranke für Datenübermittlungen
Im Geltungsbereich der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist diese Weitergabe von Daten der Käufer durch den Händler an den PoD-Dienstleister grundsätzlich über Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO gerechtfertigt.
Diese Vorschrift legitimiert Datenverarbeitungen (so auch die Weitergabe), sofern diese für die Abwicklung von Verträgen erforderlich sind.
Um Print-on-Demand-Aufträge datenschutzkonform abzuwickeln, ist allerdings sicherzustellen, dass nur solche Daten an den PoD-Dienstleister weitergegeben werden, die für die Lieferung auch unbedingt notwendig sind. Dies sind regelmäßig nur Vor- und Nachname sowie die Lieferanschrift. Für die Weitergabe zusätzlicher Daten, etwa der Mailadresse oder der Telefonnummer, bedarf es regelmäßig einer gesonderten datenschutzrechtlichen Rechtfertigung und mithin im Zweifel der vorherigen Einwilligung des Kunden.
2. Gefahr rechtswidriger Drittstaatentransfers
Sitzt der PoD-Dienstleister im außereuropäischen Ausland, ist ferner zu beachten, dass die Übermittlung von Bestelldaten an den PoD-Dienstleister nur dann zulässig ist, wenn nach der DSGVO für das Zielland geeignete Datenschutzgarantien attestiert sind.
Dies ist grundsätzlich nur dann der Fall, wenn die EU-Kommission für dieses Land einen Angemessenheitsbeschluss (Liste hier) erlassen hat, der ein mit der EU vergleichbares Datenschutzniveau bescheinigt.
Insbesondere bei PoD-Dienstleistern mit Sitz in den USA zu beachten, dass ein Angemessenheitsbeschluss die Rechtskonformität von Datenübermittlungen nur dann sicherstellt, wenn der PoD-Dienstleister sich für das EU-US-Data-Privacy-Framework zertifiziert hat.
Datenweitergaben an PoD-Dienstleister in Drittstaaten, für die keine Angemessenheitsbeschlüsse existieren (etwa: China, Australien, Russland), sollten wegen latenter Datenschutzwidrigkeit zwingend unterlassen werden.
3. Vertrag über die Auftragsdatenverarbeitung (AV-Vertrag)?
Entgegen einer teilweise vertretenen Auffassung handelt es sich bei der Einschaltung eines oder mehrerer PoD-Dienstleister *nicht um eine tatbestandliche Auftragsverarbeitung* im Sinne des Art. 28 DSGVO.
Den PoD-Dienstleistern fehlt es insofern an der erforderlichen Weisungsgebundenheit. In der Folge müssen Händler keine Auftragsverarbeitungsverträge (AV-Verträge) mit den PoD-Dienstleistern schließen.
4. Belehrung in der Datenschutzerklärung
Zwingend erforderlich ist gemäß Art. 13 DSGVO aber in jedem Fall, dass der Händler über die Weitergabe von Käuferdaten an den/die PoD-Dienstleister im Rahmen seiner Datenschutzerklärung vollständig aufklärt und die Dienstleister als Datenempfänger auch konkret benennt.
Tipp:
Die Datenschutzerklärungen der IT-Recht Kanzlei, die als Teil spezieller Rechtstexte-Schutzpakete mit vollständiger Eignung für PoD-Modelle angeboten werden, beinhalten Klauseloptionen für alle gängigen PoD-Dienstleister.
Wahrung von Urheber- und Markenrechten
Beim Verkauf von PoD-Produkten sind die Grenzen des Urheber- und Markenrechts in besonderem Maße zu beachten.
1. Urheberrecht
So wird das Urheberrecht vor allem beim Angebot der PoD-Motive relevant und verbietet es, Designs aus fremder Urheberschaft zu vermarkten, sofern hierfür keine entsprechenden Lizenzen des Rechteinhabers vergeben wurden.
Gleichzeitig können auch eigene Designs fremde Urheberrechte verletzen, wenn diese auf dritten Motiven aufbauen und diesen so ähneln, dass das Ausgangsmotiv als Grundlage bei wertender Betrachtung nach wie vor den Kern des Designs bildet.
Der Verkauf von mit urheberrechtsverletzenden Motiven bedruckten Produkten stellt immer eine urheberrechtliche Verletzungshandlung im kommerziellen Bereich dar, welche mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen gemäß § 97 UrhG geahndet werden kann.
PoD-Händler sollten sich bei Auswahl der für den Druck verfügbaren Entwürfe und Designs also zwingend versichern, nur Gestaltungen anzubieten, die keine Urheberrechte Dritter beinträchtigen.
2. Markenrecht
Für Motive und Designs ebenfalls problematisch können bestehende Markenrechte werden.
So sind eine Vielzahl von Firmenzeichen und Logos, aber etwa auch einzelne Schriftzüge, markenrechtlich geschützt und dürfen vom Händler nicht ohne Weiteres für den Aufdruck auf Artikel zum Verkauf angeboten werden.
Derartige Verwertungshandlungen stehen nämlich ausschließlich dem Markeninhaber zu, der die Aufbringung seiner Markenzeichen auf PoD-Produkten für eine zulässige Verwendung gegenüber dem Händler ausdrücklich lizenzieren müsste.
Ermöglicht der Händler ohne eine solche Lizenz den Kauf von mit fremden Markenzeichen bedruckten Produkten, begeht er eine Markenrechtsverletzung, die mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen nach § 14 MarkenG verfolgt werden kann.
Bei der Auswahl angebotener Motive und Designs müssen PoD-Händler zur Vorbeugung von Markenrechtsverletzungen also zwingend besondere Sorgfalt walten lassen.
3. Customer Content
Das Potenzial von Verletzungen geistiger Eigentumsrechte ist besonders hoch, wenn der PoD-Händler auch die Bedruckung mit vom Kunden selbst eingereichten Motiven zulässt.
Da der Händler hier keine Vorauswahl unter Beachtung fremder Rechte treffen kann, läuft er Gefahr, eine Rechtsverletzung zu perpetuieren, indem er ein vom Kunden übermitteltes geschütztes Motiv kommerziell für den Verkauf eines PoD-Produktes verwendet.
Um sich gegen Ansprüche von Rechteinhabern abzusichern, die aus der Verarbeitung von Kundenmotiven herrühren, sollten sich PoD-Händler daher in Ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) zwingend Regressansprüche gegen den Kunden vorbehalten, dank derer sie sich bei Inanspruchnahme infolge von rechtsverletztendem Customer Content schadlos halten können.
Tipp:
Die AGB der IT-Recht Kanzlei, die als Teil spezieller Rechtstexte-Schutzpakete mit vollständiger Eignung für PoD-Modelle angeboten werden, beinhalten rechtskonforme Regressregelungen für Fälle der Inanspruchnahme nach Verarbeitung rechtswidriger Kundenmotive und -designs.
Weitergehende Rechtspflichten für die Verkehrsfähigkeit von Print-on-Demand-Produkten
PoD-Händler, die verkaufte Produkte direkt über PoD-Dienstleister an den Käufer liefern lassen, sehen sich je nach Ausgestaltung des PoD-Modells gegebenenfalls weitgehenden zusätzlichen Rechtspflichten gegenüber, welche das harmonisierte Gemeinschaftsrecht an die Verkehrsfähigkeit von Produkten knüpft.
Von Relevanz sind hier insbesondere die Vorgaben des Verpackungsrechts, des Produktsicherheitsrechts und spezieller Rechtsakte für gewisse Kategorien von Produkten (z.B. Textilien.).
Ob und inwieweit PoD-Händler durch die Spezialvorschriften unmittelbar in die Pflicht genommen werden, hängt nicht zuletzt davon ab, ob die PoD-Produkte aus dem außereuropäischen Ausland geliefert werden oder von Dienstleistern innerhalb des europäischen Wirtschaftsraums stammen. Deswegen wird im Nachfolgenden eine differenzierte Betrachtung angestellt.
1. Verpackungsrechtliche Pflichten
Nach dem geltenden Verpackungsgesetz sind Hersteller von Verkaufs- und Versandverpackungen verpflichtet, sich einerseits bei der zuständigen Zentralen Stelle Verpackungsregister (ZSVR) zu registrieren und andererseits das Verpackungsmaterial bei einem Dualen System zu lizenzieren.
Dadurch soll sichergestellt werden, dass an Endverbraucher abgegebene Verpackungen einem ordnungsgemäßen Entsorgungskreislauf zugeführt werden.
Bei fehlender Registrierung und/oder Lizenzierung des verwendeten Verpackungsmaterials besteht gemäß § 9 Abs. 5 Sart 2 VerpackG und § 7 Abs. 7 Satz 1 VerpackG ein Vertriebsverbot für den Händler. Er darf Ware in nicht registrierten bzw. nicht lizenzierten Verpackungen also nicht verkaufen.
Verpflichteter Hersteller im Sinne des Verpackungsrechts ist nach § 3 Abs. 14 VerpackG aber grundsätzlich nur derjenige, der Verpackungen erstmals mit Ware befüllt und an private Endverbraucher abgibt.
a. Grundsatz: Verantwortlichkeit des PoD-Dienstleisters
Zwar haben nach § 7 Abs. 7 Satz 3 Halbsatz 2 VerpackG Händler die verpackungsrechtlichen Pflichten ihrer Fulfillment-Dienstleister zu übernehmen.
Nach § 3 Nr. 14c VerpackG gilt als Fulfillment-Dienstleister hierbei jede natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, die im Rahmen einer Geschäftstätigkeit mindestens zwei der folgenden Dienstleistungen für Vertreiber anbietet: Lagerhaltung, Verpacken, Adressieren und Versand von Waren, an denen sie kein Eigentumsrecht hat.
Beim PoD-Verkauf weist ein Online-Händler im Wege des Streckengeschäfts nach einem Kaufvertragsschluss aber einen fremden Wareneigentümer (nämlich den PoD-Dienstleister) an, das Eigentum mit individueller Bedruckung direkt an Kunden des Händlers im Zuge der Lieferung zu übertragen.
PoD-Dienstleister sind damit regelmäßig keine Fulfillment-Dienstleister im Sinne von § 3 Nr. 14c VerpackG, weil sie die Versendung von Waren in ihrem, nicht in fremdem Eigentum handhaben.
Dies führt in PoD-Konstellationen grundsätzlich zu einer Auslagerung der Verantwortlichkeit vom Online-Händler auf den PoD-Dienstleister: weil nur der PoD-Dienstleister die Verpackungen mit Ware befüllt und an den Käufer (Endverbraucher) abgibt, ist auch grundsätzlich allein der Dienstleister der verpackungsrechtlich Verpflichtete. Nicht der PoD-Händler, sondern sein Lieferant (also der PoD-Dienstleister) hat sich insofern bei der ZSVR zu registrieren und muss das Verpackungsmaterial lizenzieren.
Hinweis:
Anders sieht die Konstellation aus, wenn der PoD-Händler selbst Eigentümer der Rohware ist und nur den Druck und die Lieferung, nicht aber auch die Warenbeschaffung, beim PoD-Dienstleister in Auftrag gibt.
Übermittelt der Händler zur Abwicklung eines PoD-Auftrages das Ausgangsprodukt aus eigenem Bestand an den PoD-Dienstleister, damit dieser es bedruckt und versendet, ist der PoD-Dienstleister als Fulfillment-Anbieter im Sinne des Verpackungsrechts anzusehen und den Händler treffen für das verwendete Verpackungsmaterial die Registrierungs- und Lizenzierungspflichten des Verpackungsrechtes selbst.
b. Ausnahme
Eine Ausnahme von der grundsätzlichen Verantwortlichkeit des PoD-Dienstleisters für Verpackungen gilt aber dann, wenn außen auf der Versandverpackung ausschließlich der Online-Händler erkennbar ist.
Ergibt sich auf der Verpackung keinerlei Hinweis auf die Identität des PoD-Dienstleisters und ist allein der Online-Händler darauf als Absender gekennzeichnet, ist letzterer selbst und anstelle des PoD-Dienstleisters systembeteiligungs- und registrierungspflichtig.
c. Vorsicht bei PoD-Lieferungen aus dem Ausland
Vorsicht ist aber geboten, wenn der Händler auf nicht in Deutschland ansässige PoD-Dienstleister für Bestellausführungen zurückgreift.
Ob diese aus anderen EU-Mitgliedstaaten oder aus dem außereuropäischen Ausland stammen, ist insofern irrelevant, weil die verpackungsrechtlichen Pflichten in jedem EU-Mitgliedstaat einzeln erfüllt werden müssen.
Bei ausländischen Dienstleistern ist zu beachten, dass diese sich in Deutschland meist nicht ordnungsgemäß nach dem VerpackG registrieren lassen und gleichsam ihren Lizenzierungspflichten nicht nachkommen.
Um dem Vertriebsverbot zu entgehen, das entsteht, wenn ausländische PoD-Dienstleister in Deutschland nicht ordnungsgemäß verpackungsrechtlich registriert sind oder ihr Verpackungsmaterial nicht lizenziert haben, sind die PoD-Händler im Zweifel gehalten, die Verpackung selbst im eigenen Namen zu registrieren und zu lizenzieren.
Um die bestmögliche Transparenz sicherzustellen und das verpackungsrechtliche Pflichtprogramm des Händlers bei PoD-Aktivitäten einzudämmen, kann vom jeweiligen PoD-Dienstleister vor dessen Einspannung ein Nachweis der ordnungsgemäßen Registrierung und Lizenzierung nach dem Verpackungsgesetz angefordert werden.
2. Pflichten nach dem Produktsicherheitsrecht
Das europäische Produktsicherheitsrecht, das in Deutschland maßgeblich im Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) verankert ist, verpflichtet primär Inverkehrbringer von Produkten dazu, für deren sicherheitsrechtliche Konformität zu sorgen.
Neben Anforderungen an die Produktgestaltung nach technischen Sicherheitsstandards müssen Inverkehrbringer insbesondere auch die risikominimierende Produktanwendung sicherstellen.
Ihnen wird daher ein umfangreiches Pflichtprogramm auferlegt, welches vor allem die folgenden Ausprägungen hat:
- Bereitstellung notwendiger Gebrauchsanleitungen und Warnhinweise in deutscher Sprache (§ 3 Abs. 2 ProdSG)
- Angabe von Firma und Anschrift auf dem Produkt selbst und nur in Ausnahmen alternativ auf der Verpackung (§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ProdSG)
- Kennzeichnung des Verbraucherprodukts mit Modell – oder Typennummern zur eindeutigen Identifikation (§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 ProdSG)
- wo erforderlich Anbringung einer CE-Kennzeichnung und Durchlaufen des hierfür erforderlichen Konformitätsverfahrens (§ 7 ProdSG)
Detaillierte Ausführungen zu den Rechtspflichten des Produktsicherheitsgesetzes und deren Umsetzung stellt die IT-Recht Kanzlei in diesem Leitfaden bereit.
Im Angesicht des produktsicherheitsrechtlichen Pflichtprogramms ist für die Verantwortlichkeit von PoD-Händlern nun maßgeblich zwischen PoD-Lieferungen aus dem EU-Inland und aus dem außereuropäischen Ausland zu differenzieren.
a. PoD-Lieferungen aus dem EWR
Werden für die Bestellausführung und Lieferung PoD-Dienstleister aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) eingeschaltet, sind grundsätzlich diese nach dem ProdSG als Hersteller bzw. Inverkehrbringer verpflichtet.
Eine Verantwortlichkeit nach dem ProdSG wird nämlich durch die erstmalige Bereitstellung eines Produktes auf dem EU-Binnenmarkt begründet, wobei die Einfuhr in den EWR dieser Marktbereitstellung gleichsteht (§ 2 Nr. 15 ProdSG). Die Marktbereitstellung ist wiederum als „Abgabe zum Verbrauch oder zur Verwendung im Rahmen einer Geschäftstätigkeit“ definiert.
Bedienen sich PoD-Händler europäischer PoD-Dienstleister, trifft letztere regelmäßig die produktsicherheitsrechtliche Verantwortung, weil sie in ihrer Sphäre das Produkt entweder selbst herstellen oder in ihrem Namen aus dem außereuropäischen Ausland importieren.
Der PoD-Händler gilt also nicht selbst als Inverkehrbringer, wenn er ein auf dem EU-Markt durch ein anderes Unternehmen bereitgestelltes Produkt an Käufer innerhalb der EU liefern lässt.
Völlig pflichtlos sind PoD-Händler aber in dieser Konstellation nicht gestellt: sie trifft gemäß § 6 Abs. 5 ProdSG eine Mitwirkungspflicht dergestalt, dass sie keine Produkte anbieten dürfen, von denen sie wissen oder wissen müssen, dass sie den Vorschriften des ProdSG nicht entsprechen.
Hinweis: im Jahr 2017 hat der BGH der händlerischen Mitwirkungspflicht einen extensiven Geltungsbereich verschafft und eine Haftung von Händlern für Kennzeichnungsdefizite von Herstellern/Inverkehrbringern begründet. Mehr zur Grundsatzentscheidung lesen Sie in diesem Beitrag.
b. PoD-Lieferungen von außerhalb des EWR
Anders sieht die Rechtslage aber aus, wenn PoD-Händler Dienstleister aus dem außereuropäischen Ausland (etwa China) beauftragen und die Ware unmittelbar von diesen Lieferanten nach Europa eingeführt und an den Käufer geliefert wird.
Beim Print-on-Demand-Verkauf, der an den Direktversand von Produkten der PoD-Dienstleister aus dem außereuropäischen Ausland anknüpft, ist der Händler regelmäßig der Inverkehrbringer im Sinne des ProdSG.
Inverkehrbringer ist nämlich (unter anderem), wer ein außereuropäisches Produkt eines außereuropäischen Herstellers auf dem europäischen Markt bereitstellt, wobei die Marktbereitstellung die Abgabe zum Verbrauch oder zur Verwendung im Rahmen einer Geschäftstätigkeit bedeutet.
Gemäß Art. 6 der EU-Verordnung Nr. 2019/1020](/neue-verordnung-produktsicherheit-online-haendler.html) gilt wiederum bereits das reine Anbieten von Produkten aus Nicht-EWR-Staaten im Wege des elektronischen Geschäftsverkehrs als tatbestandliche Marktbereitstellung.
Um Bußgelder oder gar Strafen sowie sensible Verbraucherklagen zu vermeiden, hat der Händler vor der Lieferung von PoD-Produkten aus Nicht-EWR-Staaten bereits sicherzustellen, dass diese Produkte alle Vorgaben des ProdSG einhält und dass insbesondere die Produktkennzeichnung auf seine Person zugeschnitten ist.
3. Produktspezifische Kennzeichnungs- und Informationspflichten
Neben dem produktsicherheitsrechtlichen Pflichtprogramm entfalten bei PoD-Geschäftsmodellen gegebenenfalls auch produktspezifische Rechtspflichten besondere Relevanz.
In Betracht kommen vor allem die für Textilien geltenden Pflichten zur Kennzeichnung der Faserzusammensetzung gemäß der EU-Textilkennzeichnungsverordnung.
Die Aufteilung der Verantwortlichkeit zwischen PoD-Händler und PoD-Dienstleister folgt auch hier den gleichen Prinzipien.
Lassen PoD-Händler Textlilien von PoD-Dienstleistern mit Sitz innerhalb des EWR bedrucken und versenden, treffen die maßgeblichen Pflichten nicht den Händler, sondern den PoD-Dienstleister.
Werden dahingegen Textilien auf Veranlassung des PoD-Händlers in den EWR eingeführt, muss der Händler die Erfüllung der spezifischen Kennzeichnungspflichten in eigener Verantwortung als maßgeblicher Inverkehrbringer sicherstellen.
Fazit
Vor allem auf dem Gebiet des Online-Handels ist „Print-on-Demand“ seit geraumer Zeit auf dem Vormarsch. Zu den wirtschaftlichen Chancen, die dieses Geschäftsmodell gerade für kleinere und mittelständische Unternehmer bietet, gesellen sich aber stets eine Reihe von rechtlichen Besonderheiten, die es bei der Entscheidung für das Print-on-Demand-Prinzip zu beachten gilt.
Neben für den PoD-Verkauf unabdinglichen Rechtstexten in Form von AGB, Datenschutzerklärung, Widerrufsbelehrung und Impressum ist auf die gewissenhafte vertragsrechtliche Gestaltung von PoD-Lieferverhältnissen sowie insbesondere auf den rechtskonformen Umgang mit dem Verbraucherwiderrufsrecht und dem Datenschutz zu achten.
Gleichzeitig muss zur Vermeidung von rechtlichen Auseinandersetzungen der gegebenenfalls bestehende urheberrechtliche und/oder markenrechtliche Schutz von PoD-Motiven und -Designs geachtet werden.
Weitere Fallstricke können bei Beauftragung von PoD-Dienstleistern aus dem außereuropäischen Ausland hinzukommen und ein nicht unerhebliches Programm von Rechtspflichten für die Verkehrsfähigkeit von Produkten begründen, welche vom Händler in eigener Verantwortung zu erfüllen sind.
Fragen zum Beitrag? Diskutieren Sie hierzu gerne mit uns in der Unternehmergruppe der IT-Recht Kanzlei auf Facebook.
Link kopieren
Als PDF exportieren
Per E-Mail verschicken
Zum Facebook-Account der Kanzlei
Zum Instagram-Account der Kanzlei

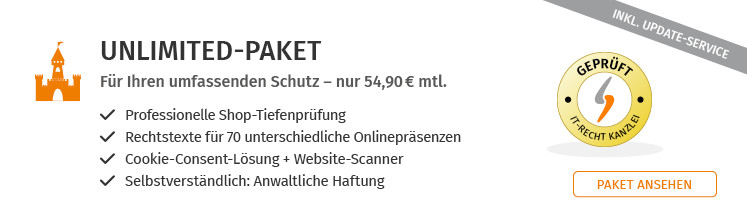




0 Kommentare