OLG Oldenburg: Fehlende CE-Kennzeichnung ist per se kein Sachmangel

Für viele Produkte ist die Kennzeichnung mit dem CE-Zeichen vorgeschrieben. In der Praxis kommt es immer wieder vor, dass eigentlich CE-kennzeichnungspflichtige Produkte kein CE-Zeichen tragen. Ist die Ware dann allein wegen dieses formalen Defizits als mangelhaft anzusehen?
Worum geht es?
Fast jeder kennt es: das CE-Zeichen, welches auf einer Vielzahl von Produkten des täglichen Lebens prangt. Für bestimmte Produktgruppen ist die Kennzeichnung mit dem CE-Zeichen gesetzlich vorgeschrieben. Fehlt das CE-Zeichen, ist das Produkt nicht verkehrsfähig in der EU.
Betroffen sind etwa Elektrogeräte, Spielzeuge, Medizinprodukte, Maschinen oder Bauprodukte (und viele weitere Produktgruppen).
Wer solche Produkte herstellt oder in der EU in den Verkehr bringen möchte, muss diese an den technischen Vorgaben bestimmter harmonisierter Normen messen. Diese legen gewisse Grundanforderungen hinsichtlich der Produktsicherheit und des Gesundheitsschutzes fest, welche die betroffenen Produkte dann erfüllen müssen.
Diese Konformität ermittelt grundsätzlich der Hersteller und erklärt diese schließlich im Rahmen einer sog. Konformitätserklärung. Um die Konformität nach außen hin, vor allem gegenüber den Behörden, zu dokumentieren, bringt er zudem auf jedem Produkt das CE-Zeichen an.
Hintergrundinformationen zum Thema CE-Zeichen finden Sie gerne hier
Nicht immer klappt dies in der Praxis reibungslos.
Doch wie ist die rechtliche Lage, trägt ein CE-kennzeichnungspflichtiges Produkt das CE-Zeichen gar nicht? Dazu hat im Jahre 2018 das OLG Oldenburg entschieden.
Bei den Fenstern war nicht „alles klar“
Im Rahmen des Rechtsstreits, welcher in der Berufung durch das OLG Oldenburg mit Urteil vom 04.09.2018, Az.: 2 U 58/18 entschieden wurde, verklagte ein Bauherr einen Fensterbauer.
Dieser hatte im Haus des Klägers Fenster- und Türenelemente nebst Rollläden verbaut. Dabei handelt es sich um Bauprodukte, die der CE-Kennzeichnungspflicht unterfallen.
Zuvor muss für diese vom Hersteller eine besondere Form der Konformitätserklärung (hier: „Leistungserklärung“) ausgestellt werden. Danach sind die Bauprodukte mit dem CE-Zeichen zu versehen. Mit anderen Worten: Auf den Fenstern, Türen und Rollläden hätte hier jeweils das CE-Zeichen prangen müssen.
Die verbauten Bauprodukte trugen hier aber jedenfalls teilweise keinerlei CE-Kennzeichnung. Für die Fenster bestand zumindest eine Leistungserklärung, für die Rollläden war auch eine solche nicht vorhanden.
Der Kläger zahlte die vereinbarte Vergütung an den Fensterbauer, war danach aber mit der Beschaffenheit der verbauten Elemente nicht zufrieden und forderte den Beklagten mehrfach zur Nachbesserung auf. Diese erfolgte nicht nach den Vorstellungen des Klägers.
Daraufhin verklagte der Bauherr den Fensterbauer auf Schadensersatz wegen fiktiver Mängelbeseitigungskosten vor dem Landgericht Oldenburg, weil dieser mangelhafte Bauelemente verbaut habe.
Das Landgericht sprach die Forderung in weiten Teilen zu und sah eine mangelhafte Leistung des Beklagten, weil die Elemente kein CE-Zeichen trugen.
Der verurteilte Fensterbauer ging gegen das landgerichtliche Urteil in Berufung, über welche nun das OLG Oldenburg zu befinden hatte.
Die Entscheidung des OLG
Das OLG sah die Berufung als begründet an, hob das landgerichtliche Urteil auf und verwies den Rechtsstreit zur erneuten Entscheidung an das Landgericht Oldenburg zurück, weil noch eine umfangreiche Tatsachenwürdigung im Wege einer Beweisaufnahme zu erfolgen hat.
Zum einen war die Berufung deswegen erfolgreich, weil im landgerichtlichen Verfahren ein erheblicher Verfahrensfehler unterlaufen ist. Das Verfahrensrecht des Beklagten auf rechtliches Gehör war schwerwiegend verletzt worden.
Zum anderen drang der Beklagte deswegen durch, weil nach Ansicht des Senats jedenfalls aus Rechtsgründen alleine wegen des fehlenden CE-Zeichens kein Sachmangel im Sinne des BGB vorliegt.
Denn die CE-Kennzeichnung nicht in erster Linie, bei Bauprodukten die Bauwerkssicherheit zu gewährleisten, sondern vorrangig, die technischen Anforderungen in Bezug auf Bauprodukte europaweit zu harmonisieren und den Handel mit Bauprodukten dadurch grenzübergreifend im Binnenmarkt zu erleichtern.
Nach Ansicht der Richter könne sich eine mangelhafte Leistung des Fensterbauers im Zusammenhang mit der CE-Kennzeichnung allein dann ergeben, wenn die verbauten Produkte nicht den bauordnungsrechtlichen Anforderungen entsprechen, die an ihre Verwendbarkeit gestellt werden.
Mit anderen Worten: Genauso wenig, wie das Vorhandensein des CE-Zeichens ein Indiz dafür ist, dass es sich um mangelfreie Ware handelt ist dessen Fehlen bei CE-kennzeichnungspflichtigen Produkten ein Indiz dafür, dass diese Produkte mangelhaft sind.
Vielmehr muss das Produkt dann an einem „materiellen“ Mangel leiden, z.B. weil es so (schlecht) konstruiert oder gefertigt ist, dass es maßgebliche Sicherheitsvoraussetzungen nicht erfüllen kann.
Etwas anderes gilt natürlich dann, wenn die Vertragsparteien das Vorhandensein der CE-Kennzeichnung ausdrücklich in eine Beschaffenheitsvereinbarung der Ware aufgenommen haben.
Ausführungen des Gerichts zur Ablehnung eines Sachmangels
Das OLG nahm zu diesem Punkt wie folgt Stellung:
„Allein wegen des Fehlens der CE-Kennzeichnung liegt aus Rechtsgründen kein Mangel vor.
a) Die wesentlichen Grundsätze der CE-Kennzeichnung von Bauprodukten sind in der Verordnung (EG) Nr. 305/2011 vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates (im Folgenden: BauPVO) EU-einheitlich geregelt. Deren Regelungszweck liegt allerdings nicht darin, die Bauwerkssicherheit zu gewährleisten, sondern sie bezweckt vornehmlich, die technischen Anforderungen an Bauprodukte europäisch zu harmonisieren und dadurch den Handel mit Bauprodukten im Binnenmarkt zu erleichtern (vgl. Halstenberg, BauR 2017, 356, 370; Zmuda, BauR 2018, 1170, 1172). Dementsprechend ist im 3. Erwägungsgrund der BauPVO niedergelegt, dass das Recht der Mitgliedstaaten unberührt bleiben soll, „Anforderungen festzulegen, die nach ihrer Auffassung notwendig sind, um den Schutz der Gesundheit, der Umwelt und von Arbeitnehmern, die Bauprodukte verwenden, sicherzustellen“. Die Gewährleistung der Bauwerkssicherheit bleibt also nationale Aufgabe (vgl. Zmuda, BauR 2018, 1170, 1172; Fehse, BauR 2018, 1197, 1198).
Vor diesem Hintergrund verlangt die BauPVO von dem Hersteller, der ein Bauprodukt in den Verkehr bringt, allein eine sogenannte Leistungserklärung, sofern das Bauprodukt einer harmonisierten Norm unterfällt (Art. 4 BauPVO). Die harmonisierten Normen definieren sog. wesentliche Merkmale und legen in Bezug auf diese ein Prüfverfahren fest (vgl. Fehse, BauR 2018, 1197, 1198). Der Hersteller hat in der Leistungserklärung anzugeben, welche Merkmale geprüft wurden, wie geprüft wurde und welches Ergebnis erzielt wurde. Mithin werden durch die BauPVO bzw. die harmonisierten Normen keine Anforderungen an die Bauprodukte festgelegt, sondern allein einheitliche Prüfstandards definiert (vgl. Zmuda, BauR 2018, 1170, 1172). Ob die ermittelten Leistungen dem entsprechen, was nach den nationalen bauaufsichtlichen Vorschriften der Mitgliedstaaten erforderlich ist, ergibt sich aus den harmonisierten Normen und damit der Leistungserklärung des Herstellers nicht (Halstenberg, BauR 2017, 356, 370). Dementsprechend handelt es sich bei der Leistungserklärung um eine eigene Erklärung des Herstellers, die er in eigener Verantwortung abgibt. Sie hat den Inhalt, dass das Produkt allen geltenden Anforderungen des anzuwendenden Unionsrechts betreffend die Erlangung der CE-Kennzeichnung genügt und ein geeignetes Konformitätsbewertungsverfahren durchgeführt wurde (Art. 6 i.V.m. Anlage III BauPVO). Mit der Anbringung der CE-Kennzeichnung bekundet der Hersteller sichtbar die erfolgreiche Konformitätsbewertung, jedoch ausschließlich aus seiner subjektiven Sicht (Art. 8 BauPVO).
Gerade vor dem Hintergrund der unzureichenden Standards der BauPVO bzw. der ihr vorausgegangen Bauproduktenrichtlinie in Bezug auf die Bauwerkssicherheit hatte der deutsche Gesetzgeber über die Landesbauordnungen auf Bauregellisten verwiesen und damit zusätzliche nationale Anforderungen an bereits europäisch harmonisierte und mit dem CE-Kennzeichen versehene Bauprodukte formuliert. Die Einhaltung dieser Anforderungen war Voraussetzung für die Erteilung eines sog. Ü-Kennzeichens (vgl. Fehse, BauR 2018, 1197, 1199). Diese Praxis hat der EuGH für unzulässig erklärt (vgl. EuGH NZBau 2014, 692). Nach wie vor begründet daher - im Gegensatz zu den Produkten mit der früheren Ü-Kennzeichnung - die CE-Kennzeichnung keinen Verwendbarkeitsnachweis für ein bestimmtes Bauprodukt in Bezug auf alle nationalen gesetzlichen Sicherheitsanforderungen (vgl. Fehse, BauR 2018, 1197, 1198). Diese können vielmehr Angaben erfordern, die eine Leistungserklärung nicht enthalten muss (vgl. Zmuda, BauR 2018, 1170, 1173). Damit bietet die CE-Kennzeichnung keinerlei Gewähr dafür, dass das Bauprodukt den nationalen durch Gesetz festgelegten Sicherheitsanforderungen entspricht. Die harmonisierten Normen i.S. der BauPVO, auf denen die CE-Kennzeichnung beruht, spiegeln also aufgrund ihrer Funktion und ihres Inhalts nicht die deutschen anerkannten Regeln der Technik wider (vgl. Halstenberg, BauR 2017, 356, 375).“
Fazit: Differenzierte Betrachtung notwendig
Das Gericht stellte fest, dass „nur“ die fehlende CE-Kennzeichnung für sich genommen (also in formaler Hinsicht) betrachtet noch keinen Sachmangel der Bauprodukte begründen kann.
Weisen jedoch die verbauten Bauprodukte jedoch negative Abweichungen von maßgeblichen technischen Normen (die für die Bewertung der Konformität heranzuziehen sind) ab, dann dürfte hier auch das Landgericht, an welches der Rechtsstreit zurückverwiesen wurde, die Mangelhaftigkeit der Ware bejahen, insbesondere wenn dadurch die Sicherheit des Bauwerks beeinträchtigt wird.
Es muss also unterschieden werden: Ist das Produkt (sicherheits)technisch in Ordnung und fehlt nur das CE-Zeichen, dann kein Mangel. Ist das Produkt technisch dagegen mangelhaft, wird immer auch von einem Sachmangel im Sinne des BGB auszugehen sein, so dass dann die Mängelrechte des Käufers nach den §§ 437 ff. BGB eröffnet sein dürften.
Onlinehändler müssen jedoch aus einem ganz anderen Grund aufpassen: Die Rechtsprechung sieht in dem Fall, dass ein Händler CE-kennzeichnungspflichte Produkte ohne CE-Zeichen vertreibt einen abmahnbaren Wettbewerbsverstoß.
Sie möchten Ihren Onlinehandel rechtlich absichern? Werfen Sie einen Blick auf die Schutzpakete der IT-Recht Kanzlei
Fragen zum Beitrag? Diskutieren Sie hierzu gerne mit uns in der Unternehmergruppe der IT-Recht Kanzlei auf Facebook.
Link kopieren
Als PDF exportieren
Per E-Mail verschicken
Zum Facebook-Account der Kanzlei
Zum Instagram-Account der Kanzlei

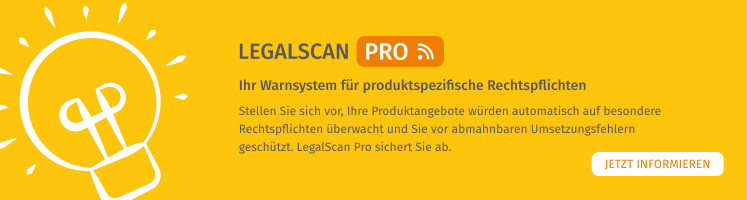
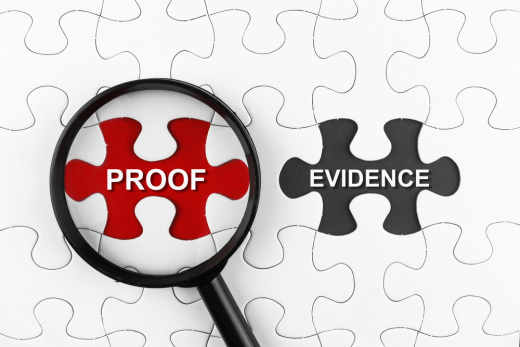

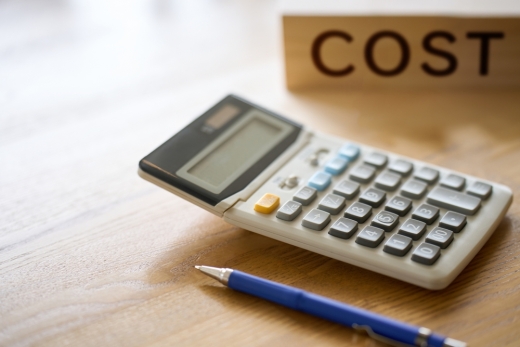
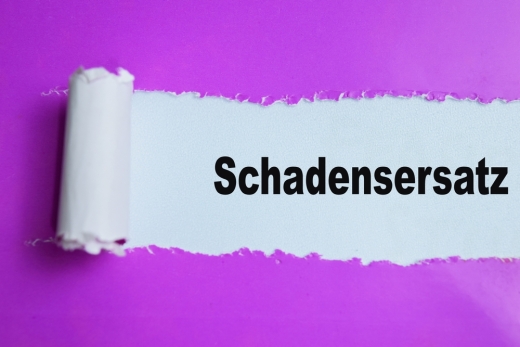

0 Kommentare