Was den Markeninhaber müde macht - Der Erschöpfungsgrundsatz im Markenrecht

Wie weit gehen die Rechte des Markeninhabers? Grundsätzlich darf dieser allein und nach freiem Belieben entscheiden, ob Dritte „sein“ geschütztes Zeichen verwenden dürfen oder nicht. Völlig grenzenlos wird dieser Ausschließlichkeitsschutz jedoch nicht gewährt. Eine gesetzliche Schranke ist der sogenannte Erschöpfungsgrundsatz, der in § 24 Abs. 1 des Markengesetzes normiert ist.
Was regelt der Erschöpfungsgrundsatz?
§ 24 Abs. 1 Markengesetz:
Der Inhaber einer Marke (…) hat nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, die Marke (…) für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke (…) von ihm oder mit seiner Zustimmung im Inland, in einem der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind.
Ist eine Marke erst einmal ordnungsgemäß in den Verkehr gebracht worden, so darf die (Weiter)Benutzung der nun bereits kursierenden, gekennzeichneten Ware dritten Personen nicht mehr untersagt werden. Zulässig sind dann sowohl der Weitervertrieb der konkreten Originalprodukte, als auch markengestützte Werbung, solange sie produkt- und nicht unternehmensbezogen erfolgt. Nach der Terminologie des Gesetzgebers ist das Ausschließlichkeitsrecht des Markeninhabers in solchen Fällen „erschöpft“.
Räumlich gesehen umfasst der Geltungsbereich des Erschöpfungsgrundsatzes nicht nur Deutschland, sondern auch die übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie die weiteren Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR).
Warum gibt es den Erschöpfungsgrundsatz?
Durch den Erschöpfungsgrundsatz soll eine Balance zwischen dem Markenschutz und dem freien Warenverkehr erreicht werden: Einerseits soll der Markeninhaber den wirtschaftlichen Wert seines Zeichens realisieren können, andererseits soll kein Händler in der nachfolgenden Kette der Veräußerungsgeschäfte durch absolute Markenrechte behindert sein. Folgerichtig wird dem Berechtigten die Entscheidung über das erstmalige Inverkehrbringen seiner gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen überlassen. Jeder Weiterverkauf durch Dritte ist aber zustimmungsfrei möglich.
Für die Praxis bedeutet dies, dass der Inhaber der Marke zum Beispiel nicht verhindern kann, dass durch ihn zunächst exportierte Waren von Dritten umgehend reimportiert und dann im Inland verkauft werden. Auch ein Parallelimport ist nach der Rechtsnorm zulässig. In einer seiner grundlegenden Entscheidungen zu diesem Thema hat der BGH außerdem festgesetzt, dass derjenige, der in In- und Ausland übereinstimmende Warenzeichen hat registrieren lassen, die Einfuhr seiner im Ausland hergestellten (unveränderten) Originalprodukte nicht untersagen kann. Auch nicht, wenn er im Inland einem Dritten ein Alleinnutzungsrecht eingeräumt hat (BGHZ 41, S. 84 ff – „Maja“).
Ab wann ist eine Ware in Verkehr gebracht?
Ein Inverkehrbringen im Sinn des § 24 MarkenG liegt dann vor, wenn die Originalware zum Zwecke des Absatzes in den freien Wettbewerb auf den Markt gelangt ist. Dies ist der Fall, wenn die Verfügungsgewalt über die mit der Marke versehenen Waren auf einen Dritten übertragen wird, wenn dieser also dazu berechtigt wird, die Produkte zu verkaufen oder zu Werbezwecken an potentielle Kunden zu überlassen.
Gibt es Ausnahmen?
Eine Ausnahme vom Erschöpfungsgrundsatz stellt § 24 Abs. 2 MarkenG dar.
§ 24 Abs. 2 MarkenG:
Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn sich der Inhaber der Marke (…) der Benutzung der Marke (…) im Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb der Waren aus berechtigten Gründen widersetzt, insbesondere wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert ist.
Nach dieser Vorschrift kann der Inhaber des Markenrechts jederzeit – auch nach dem Inverkehrbringen rechtmäßig gekennzeichneter Ware – solche Handlungen verbieten, die die Herkunfts- und Garantiefunktion seines Zeichens verletzen.
Eine solche Beeinträchtigung ist anzunehmen, wenn die Eigenart der Ware verändert wird, insbesondere, wenn eine Verschlechterung der Produkte eintritt. Zum anderen ist der Weitervertrieb aber auch dann unzulässig, wenn die Ware selbst zwar unverändert bleibt, der Ruf der Marke jedoch erheblich geschädigt wird – etwa infolge einer Umverpackung.
Wer trägt die Beweislast?
Grundsätzlich gilt: Wer eine Marke benutzt, muss beweisen, dass er dies darf. Die Beweislast für die Erschöpfung des Rechts trifft damit denjenigen, der der Markenverletzung bezichtigt wird. Er muss darlegen, dass die betreffenden Produkte vom Markeninhaber selbst oder mit seiner Zustimmung in den Verkehr gebracht worden sind. Dies gilt auch in dem Fall, in dem er die Waren von jemand anderem als dem Berechtigten erwirbt. Unkenntnis ist keine Entschuldigung, der Verwender muss sicherstellen, dass Erschöpfung eingetreten ist.
Ausnahmsweise geht die Beweislast auf den Markeninhaber über, wenn durch die Offenlegung der innereuropäischen Bezugsquellen durch den Markenverletzer dem Markeninhaber die Möglichkeit der Einflussnahme auf die Absatzmärkte eröffnet würde.
Fazit
Nicht immer ist eine markenrechtliche Abmahnung gerechtfertigt. Hat man die in Frage stehenden Produkte von einem Händler bezogen, der zu deren Vertrieb berechtigt ist, sollte man sich gegenüber dem Markeninhaber auf die Erschöpfung berufen. Allerdings ist man hierfür beweispflichtig. Die Quittungen, die von dem Erwerb herrühren, sollten daher gut aufbewahrt werden. Optimalerweise lässt man sich außerdem von dem Händler schriftlich die Freiverkäuflichkeit der Ware in der EU bestätigen - wenngleich dies im Fall der Fälle dem Verkäufer im Ergebnis allenfalls Rückgriffsrechte sichern mag.
Fragen zum Beitrag? Diskutieren Sie hierzu gerne mit uns in der Unternehmergruppe der IT-Recht Kanzlei auf Facebook.
Link kopieren
Als PDF exportieren
Per E-Mail verschicken
Zum Facebook-Account der Kanzlei
Zum Instagram-Account der Kanzlei


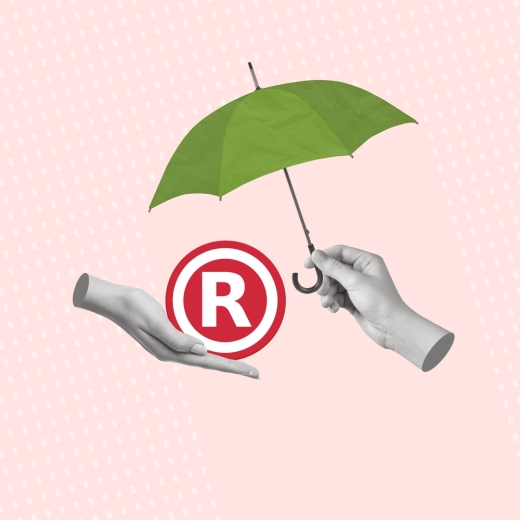



0 Kommentare