E-Mail-Werbung: Gilt die E-Mail-Adresse bei Bestellung als Einwilligung?

Händler sehen dem Inkrafttreten der DSGVO am 25.05.2018 gespannt entgegen. Die zentrale Frage bleibt: Gilt die Angabe einer E-Mail-Adresse im Bestellprozess bereits als wirksame Einwilligung in die Datenverarbeitung?
Grundsätzlich gilt das Verbot mit Erlaubnisvorbehalt
Es gilt grundsätzlich, dass die Erhebung personenbezogener Daten verboten ist, sofern sich nicht aus Normen oder durch Einwilligung der betroffenen Person etwas Anderes ergibt. Unter personenbezogenen Daten versteht man „Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person“, siehe § 3 Abs. 1 BDSG. Dazu zählen unter anderem Kontaktdaten - wie selbstverständlich auch die E-Mail-Adresse. In einem aktuellen Fall hatte sich das LG Berlin mit der Frage zu beschäftigen, ob die Angabe einer E-Mail-Adresse im Rahmen einer Bestellung bereits als Einwilligung gewertet werden kann.
LG Berlin: Ist die Angabe der E-Mail-Adresse bei der Bestellung eine Einwilligung?
Der Beklagte betrieb einen Sportartikel-Versand im Internet. Ein Kunde hatte bei besagtem Händler eine Kinderhose bestellt und bekam von diesem im Nachgang einige E-Mails mit Werbung, welche sich auf dessen gesamtes Produktportfolio bezog, per E-Mail zugeschickt. Der Kunde mahnte den Beklagten erfolglos ab und erhob Klage vor dem LG Berlin, da er der Auffassung war, ihm stehe ein Unterlassungsanspruch gemäß §§ 3, 7, 8 UWG gegen den Händler zu.
Mit Urteil vom 16.11.2017 (Az.: 16 O 225/17) stellte das LG Berlin fest, dass der Anspruch des Klägers bestehe, da es sich beim Versand der streitgegenständlichen E-Mails um eine unzumutbare Belästigung im Sinne des § 7 Abs. 1, 2 Nr. 3 UWG handele. Eine ausdrückliche Einwilligung zum Versand dieser E-Mails habe nicht vorgelegen. Zwar habe der Beklagte in seinen AGB bzw. in der Datenschutzerklärung geregelt, dass Kundendaten für Werbezwecke
genutzt werden können, jedoch genügten diese Hinweise nicht den rechtlichen Erfordernissen.
Unter Berücksichtigung des Schutzzwecks der Datenschutzrichtlinie 2002/58/EG für elektronische Kommunikation, in der der § 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG seinen Ursprung findet, sei das Vorgehen des Händlers unzulässig. Nach dieser Richtlinie müsse die Einwilligung ohne Zwang, für den konkreten Fall und in Kenntnis der Sachlage erfolgen, sofern die Person betreffende personenbezogene Daten verarbeitet würden. Insbesondere werde das Erfordernis der „spezifischen Angabe“ verletzt, welches besagt, dass eine Einwilligung gesondert eingeholt werden muss und zum Beispiel nicht in Textpassagen, welche auch andere Informationen widmen, auftauchen darf.
Auch greife die sog. „Bestandskundenausnahme“, welche in § 7 Abs. 3 UWG zu finden ist, nicht. Im Rahmen dieser Ausnahme wird es dem Händler im Rahmen bestehender Kundenbeziehungen ermöglicht, per E-Mail für weitere von ihm angebotenen Waren oder Dienstleistungen zu werben, ohne dass eine Einwilligung des Verbrauchers nötig ist. § 7 Abs. 3 UWG setzt voraus, dass alle folgenden Voraussetzungen gegeben sind:
- der Unternehmer muss die im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Ware oder Dienstleistung von dem Kunden dessen elektronische Postadresse erhalten haben
- weiter muss der Unternehmer die Adresse zur Direktwerbung für eigene ähnliche Waren oder Dienstleistungen verwendet haben
- der Kunde darf der Verwendung nicht widersprochen haben
- der Kunde muss bei Erhebung der Adresse und bei jeder Verwendung klar und deutlich darauf hingewiesen werden, dass er der Verwendung jederzeit widersprechen kann, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen
Vorliegend scheide eine Legitimierung durch § 7 Abs. 3 UWG bereits dadurch aus, da in den streitgegenständlichen E-Mails nicht ähnliche Produkte beworben würden (z.B. andere Kinderhosen), sondern Bezug zum gesamten Sortiment des Sportartikel-Händlers hergestellt würde, so das LG.
Fazit: Es gilt die „Bestandskundenausnahme“ weiterhin auch in DSGVO-Zeiten
Da mit dem Inkrafttreten der DSGVO viele Neuerungen ins Haus stehen, könnte man meinen, dass sich auch hinsichtlich der „Bestandskundenausnahme“ nach § 7 Abs. 3 UWG Änderungen ergeben. An dieser Stelle kann jedoch Entwarnung gegeben werden: In Art. 95 DSGVO ist normiert, dass die Richtlinie 2002/58/EG weiterhin gilt - somit entfaltet auch § 7 Abs. 3 UWG als „besondere Regelung“ dieser Richtlinie weiterhin Geltung.
Grundsätzlich ist also auch trotz Inkrafttreten der DSGVO am 25. Mai die Werbung durch Newsletter per E-Mail weiterhin ohne Einwilligung des Verbrauchers möglich, sofern die Voraussetzungen des § 7 Abs. 3 UWG vorliegen. Aber Vorsicht: In der Praxis sind die Voraussetzungen der Bestandskundenausnahmen oft schwer belegbar und der Versender fährt immer sicherer, wenn er eine Einwilligung hat.
Fragen zum Beitrag? Diskutieren Sie hierzu gerne mit uns in der Unternehmergruppe der IT-Recht Kanzlei auf Facebook.
Link kopieren
Als PDF exportieren
Per E-Mail verschicken
Zum Facebook-Account der Kanzlei
Zum Instagram-Account der Kanzlei

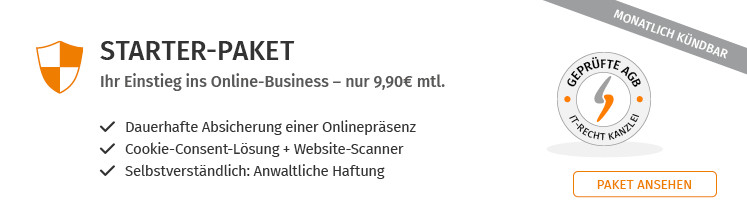




0 Kommentare