Die geographische Marke – die Herkunftsangabe als Eintragungshindernis von Marken

Geographische Herkunftsangaben können als solche schutzfähig sein oder auch als Kollektivmarke eingetragen werden – beides allerdings nur in sehr engen Grenzen. Für Individualmarken besteht zur Vermeidung einer Monopolisierung einer geographischen Angabe grds. ein Eintragungshindernis. Wie immer kommts drauf an: Das Bundespatentgericht (Beschluss vom 16. April 2013 ,Az.. 27 W (pat) 515/13) verneinte jüngst ein Freihaltebedürfnis im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG hinsichtlich der geographischen Herkunftsangabe „Lahr“ für Schuhwaren, da der Verkehr keine positiven Vorstellungen zwischen Ware und Ort verknüpfen wird.
Fall
Im Zuge der Anmeldung ihrer Wort-Bild-Marke „Lahr Schuhwerk“ bei dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) stieß die Anmelderin aus Lahr/Schwarzwald auf unerwarteten Widerstand, als die die Markenstelle das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 MarkenG als gegeben erachtete.
Nach Ansicht des DPMA bestehe für den Bestandteil „Lahr“ des angemeldeten Zeichens ein Freihaltebedürfnis, da es in der Stadt Lahr sicherlich mehrere Schuhgeschäfte gäbe.
Die Anmelderin, welche die Meinung vertrat, dass die Marke mittlerweile Verkehrsdurchsetzung erlangt habe, legte daraufhin gegen den Beschluss des Markenamts Beschwerde beim Marken-Beschwerdesenat des Bundespatentgericht ein.
Entscheidung
Wie auch die Anmelderin sah der Beschwerdesenat des BPatG im vorliegenden Fall Schutzhindernisse aus § 8 Abs. 2 MarkenG nicht gegeben und hob daher den Beschluss der Markenstelle auf.
Das BPatG stellte insbesondere klar, dass „Lahr“ auch keine für Schuhwaren freihaltebedürftige geographische Herkunftsangabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellt.
Das Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass unmittelbar warenbeschreibende Angaben, auch solcher über die geographische Herkunft, von allen Verkehrsteilnehmern frei verwendet werden können. Dies beruht vor allem darauf, dass Bezeichnungen dieser Art nicht nur die Qualität und andere Eigenschaften der betreffenden Waren anzeigen, sondern auch die Vorlieben der Verbraucher in anderer Weise beeinflussen können. Beispielsweise dadurch, dass diese eine Verbindung zwischen den Waren und Dienstleistungen und einem Ort herstellen, mit dem sie positiv besetzte Vorstellungen verknüpfen. Solche Vorstellungen können zum Beispiel auf einem bestimmten Lebensstil oder einem besonderen Flair, auf Tradition oder Modernität berufen, die der Verkehr mit dem Ort verbindet.
Zu beurteilen ist ein solches Freihaltebedürfnis anhand der objektiven Gesamtumstände des Einzelfalles. Bei Beurteilung der Gesamtumstände im vorliegenden Fall, insbesondere die wirtschaftliche Bedeutung des Ortes und der Infrastruktur der umliegenden Region, könne bei dem Ort „Lahr“ hinsichtlich der Warengruppe Schuhwerk ein Freihaltebedürfnis nicht festgestellt werden.
"Wie die Recherchen der Markenstelle haben auch die des Senats keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass Mitbewerber Schuhwaren betreffend gegenwärtig oder künftig ein Freihaltungsbedürfnis an der Herkunftsangabe „Lahr“ haben könnten. Dies liegt auch daran, dass in Lahr oder in Schwarzwald keine herausragenden Schuhwaren mit einem überregionalen Ruf hergestellt werden. Auch für die Zukunft ist eine nennenswerte wirtschaftliche Entwicklung in diese Richtung vernünftigerweise nicht zu erwarten."
Die Bezeichnung „Lahr“ könne zudem ohne den in der offiziellen Bezeichnung Lahr/Schwarzwald verwendeten Zusatz nicht den Eindruck eines typischen Ortsnamens erwecken. Somit erscheine es, so das Gericht, unwahrscheinlich, dass die angesprochenen Verbraucher für Schuhwaren einen Bezug zur Stadt Lahr annehmen werden.
"Allein ein geographischer Bezug ist wegen seiner Allgemeinheit nicht geeignet, plausibel zu
machen, dass die maßgeblichen Kreise (in Zukunft) eine Verbindung zwischen Lahr und den Schuhwaren herstellen. Die bloße theoretische Möglichkeit, dass in Lahr künftig tatsächlich Schuhe von besonderer Qualität produziert werden könnten, reicht nicht aus, die Anmeldung zurückzuweisen.Hinzu kommt, dass in der konkret beanspruchten Zeichenform nichts auf eine Verwendung von „Lahr“ als Ortsangabe hinweist. Es heißt nicht „Lahrer Schuhwerk“ und nicht einmal „Schuhwerk Lahr“, wie dies bei Betriebsbezeichnungen üblich wäre."
Im Übrigen stehe der Eintragung auch nicht das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen, da die Farbgestaltung (rot,schwarz) und die unterschiedlichen Schreibweisen mit der Aufsplitterung von Lahr seine einzelnen Buchstaben, dem Zeichen Unterscheidungskraft verleihen.
Fazit
Die Frage, ob einer geographische Angabe ein Freihaltebedürfnis zukommt, ist also niemals pauschal zu beantworten, sondern bedarf einer intensiven Gesamtprüfung der Gegebenheiten des Einzelfalles.
Zu beachten ist jedoch immer, dass ein Vorliegen des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG voraussetzt, dass die geografische Angabe zur Bezeichnung der geografischen Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen dienen könnte. Sofern eine Verwendung der Herkunftsangabe noch nicht stattfindet, ist zu prüfen, ob sie vernünftigerweise in Zukunft zu erwarten ist. Entscheidend sind dabei die tatsächlichen Gegebenheiten an dem fraglichen Ort in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen, sowie der Bekanntheitsgrad dieser Gegebenheiten bei den beteiligten Verkehrskreisen.
Fragen zum Beitrag? Diskutieren Sie hierzu gerne mit uns in der Unternehmergruppe der IT-Recht Kanzlei auf Facebook.
Link kopieren
Als PDF exportieren
Per E-Mail verschicken
Zum Facebook-Account der Kanzlei
Zum Instagram-Account der Kanzlei

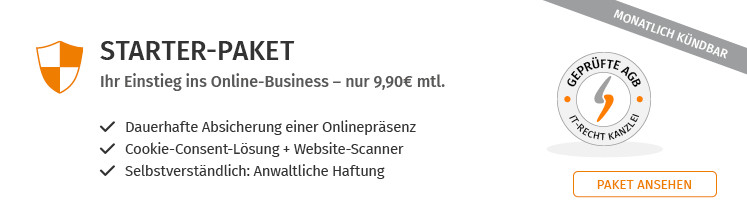





0 Kommentare