EuGH stärkt Verbraucherschutz – Beweislastumkehr stellt Händler vor neue Herausforderungen

In einem Vorabentscheidungsverfahren, mit dem der EuGH kürzlich befasst war, hatte der Gerichtshof u.a. zu klären, welche Verbraucherschutzregeln im Bereich des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter Anwendung finden. Konkret ging es zwar um niederländisches Recht, ähnliche Regelungen existieren aber auch in Deutschland. Der Gerichtshof stellte sich in seinem Urteil entgegen der ständigen Rechtsauffassung des BGH und stärkt den Verbraucherschutz. Welche Auswirkungen die Entscheidung z.B. für Gewerbetreibende haben könnte, wenn sich deutsche Gerichte der EuGH-Rechtsprechung in Zukunft anschließen, erfahren Sie im aktuellen Überblick zum EuGH-Urteil vom 4.6.2015 – Az. C-497/13.
1) Hintergrund und Verlauf des Rechtsstreits
Die Streitigkeiten begannen schon im Jahr 2008. Eine niederländische Kundin hatte damals bei einem Autohaus einen Gebrauchtwagen gekauft, der rund vier Monate nach dem Kauf während der Fahrt Feuer fing und komplett ausbrannte. Infolgedessen wurde der Gebrauchtwagen verschrottet, allerdings ohne, dass eine technische Brandursachenuntersuchung stattgefunden hatte. Die Kundin versuchte rund ein Jahr nach dem Kauf - unter Berufung auf die Vermutungsregelung einer europäischen Richtlinie, die auch im deutschen Recht umgesetzt wurde - das Autohaus für den Schaden haftbar zu machen. Das Autohaus stellte seine Verantwortlichkeit in Abrede. Die daraufhin vor einem niederländischen Gericht anhängig gemachte Klage wurde von diesem dem EuGH zur Vorabentscheidung vorgelegt. Fraglich war u.a., ob das nationale Gericht von Amts wegen zu prüfen hat, ob die Kundin als Verbraucherin im Sinne der europäischen Richtlinie 1999/44/EG anzusehen ist, auch wenn sie sich nicht ausdrücklich auf diese Vorschrift berufen hat sowie ob eine anwaltliche Vertretung an dieser Bewertung etwas ändert. Insbesondere hatte der Gerichtshof aber auch Fragen zur Vermutungswirkung und Beweislastverteilung zu klären. Ähnliche Regelungen existieren auch im deutschen Recht, wurden vom BGH jedoch bisher eng und eher zulasten der Verbraucher ausgelegt.
2) Die Entscheidung des EuGH
Der EuGH bejahte die Haftung des Autohauses. Ob die Verbraucherin sich auf diese Eigenschaft beruft oder nicht sei auch dann von Amts wegen zu prüfen, unabhängig davon, ob sie anwaltlich vertreten ist oder nicht. So konnte auch die Vermutungsregelung der Richtlinie 1999/44/EG greifen, die im Kern Folgendes besagt:
„Bis zum Beweis des Gegenteils wird vermutet, dass Vertragswidrigkeiten, die binnen sechs Monaten nach der Lieferung des Gutes offenbar werden, bereits zum Zeitpunkt der Lieferung bestanden.“
Demnach haftet der Verkäufer dem Verbraucher für jede Vertragswidrigkeit, die zum Zeitpunkt der Lieferung des Verbrauchsgutes besteht, auch wenn sie sich erst später zeigt (sog. latente Grundmangel-Haftung). Denn der kurze Zeitraum von sechs Monaten innerhalb derer sich ein Defekt zeigen muss, erlaube die Vermutung, dass ein latenter Mangel im Ansatz auch schon bei Lieferung bestanden habe. Die Mitgliedsstaaten können nach der Richtlinie im Interesse der Unternehmer lediglich vorsehen, dass der Verbraucher den Verkäufer zur Inanspruchnahme seiner Reche über die Vertragswidrigkeit binnen zwei Monaten nach dem Zeitpunkt, zu dem er die Vertragswidrigkeit festgestellt hat, unterrichten muss. Im niederländischen Recht war das der Fall.
3) Bisherige deutsche Rechtslage und Auswirkungen des Urteils
Das Urteil des EuGH steht im Gegensatz zur bisherigen BGH-Rechtsprechung. Zwar galt auch in Deutschland nach Umsetzung der Richtlinie grundsätzlich über § 476 BGB eine Beweislastumkehr zugunsten der Verbraucher. Diese galt jedoch bisher nur in zeitlicher Hinsicht. Der BGH hatte die Norm nämlich bisher einschränkend so ausgelegt, dass nur hinsichtlich des konkret vorhandenen Mangels vermutet wurde, dass dieser auch schon bei Lieferung der Sache vorhanden war. Insbesondere bei mehreren in Betracht kommenden Mangelursachen, hatten Verbraucher bisher „schlechte Karten“. Verbrauchern half die Vermutungsregelung des § 476 BGB auch in den „Grundmangel-Konstellationen“ in der Regel wenig, denn der Unternehmer konnte die Vermutung schon dadurch entkräften, indem er auf das Fehlen des Mangelsymptoms zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs verwiesen hat. Verbraucher hatten somit also zum Beispiel den Nachweis zu erbringen, dass schon bei Lieferung ein Teil der Sache mangelhaft war und genau dadurch der offensichtliche Mangel verursacht wurde.
4) Auswirkungen des EuGH-Urteils
Schließen sich deutsche Gerichte der europäischen Rechtsprechungslinie an, gelten dessen Grundsätze auch in Deutschland. Die Vermutungswirkung des § 476 BGB stellt dann v.a. Händler vor Herausforderungen, indem sie die sonst dem Verbraucher obliegende Beweislast erleichtert. Die Vermutung der Mangelhaftigkeit bei Lieferung ist zwar widerlegbar, jedoch trägt der Unternehmer nach der neuen europäischen Rechtsprechung in einem solchen Fall die Beweislast. Der Verbraucher muss nach der EuGH-Rechtsprechung nur nachweisen, dass das gebrauchte Gut nicht vertragsgemäß ist und dieser Mangel innerhalb von sechs Monaten nach Kauf offenbar geworden ist. Er muss nunmehr weder den Grund noch den Umstand beweisen, dass die Vertragswidrigkeit dem Verkäufer zuzurechnen ist. Es ist hingegen Sache des Gewerbetreibenden, den Beweis zu erbringen, dass die Vertragswidrigkeit zum Zeitpunkt der Lieferung des Gutes noch nicht vorlag, indem er darlegt, dass sie ihren Grund oder Ursprung z.B. in unsachgemäßem Gebrauch der Sache durch den Kunden, also nach Lieferung hat. Dieser Beweis ist in der Regel mit einem größeren Aufwand verbunden.
Beweislastverteilung nach deutscher und europäischer Rechtslage:
Nach deutscher Rechtslage hätte der Unternehmer darauf verweisen können, dass das Fahrzeug bei Lieferung noch nicht brannte, mit der Folge, dass die Käuferin die Beweislast getragen hätte. Dies hätte die Verbraucherin vor kaum lösbare Schwierigkeiten gestellt, da der Wagen mittlerweile verschrottet war.
Nach EuGH-Rechtsprechung ist durch den Verbraucher im Kern nur noch zu beweisen, dass sich die Sache innerhalb von 6 Monaten nach Lieferung als nicht vertragsgemäß erwiesen hat. Dies wird bei derart gravierenden Symptomen wie einem Brand jedoch keine allzu großen Schwierigkeiten bereiten. Der Unternehmer trägt indes nunmehr die Beweislast dafür, dass die Ursache erst nach der Lieferung der Sache eingetreten ist und zum Beispiel auf Bedien- und Fahrfehler der Verbraucherin zurückzuführen ist.
5) Fazit
Der EuGH bekräftigt in seiner Entscheidung erneut den Verbraucherschutz, denn „mit der europäischen Richtlinie über bestimmte Aspekte von Verbraucherverträgen soll der Schutz von Verbrauchern sichergestellt werden“. Die Vermutung der Mangelhaftigkeit einer Sache nach § 476 BGB könnte sich damit auch auf versteckte Mängel erstrecken, wenn sie sich relativ zeitnah nach Lieferung zeigen. Verbraucher müssten dann deren konkreten Grund oder Ursache nicht beweisen. Betroffen wären auch deutsche Unternehmer und dies sogar, wenn sie gebrauchte Sachen verkaufen und für eine etwaige Vertragswidrigkeit selbst gar nicht originär verantwortlich sind.
Das Vertrauen auf die bisherige Rechtsprechung ist für Händler risikoreich, da sich deutsche Gerichte der EuGH-Rechtsprechung anschließen könnten und die Norm künftig verbraucherfreundlicher auslegen. Gewerbetreibende sollten sich also darauf einstellen, in Zukunft die Mangelfreiheit einer Sache zum Kauf- bzw. Übergabezeitpunkt oder die eindeutige Verursachung durch den Kunden nachweisen zu müssen. Dies kann auch den Nachweis beinhalten, dass ein bis zu sechs Monate später auftretender Mangel nicht doch schon bei Lieferung im Ansatz vorhanden war.
Tipp: Fragen zum Beitrag? Diskutieren Sie hierzu gerne mit uns in der Unternehmergruppe der IT-Recht Kanzlei auf Facebook .
Link kopieren
Als PDF exportieren
Per E-Mail verschicken
Zum Facebook-Account der Kanzlei
Zum Instagram-Account der Kanzlei
Beiträge zum Thema





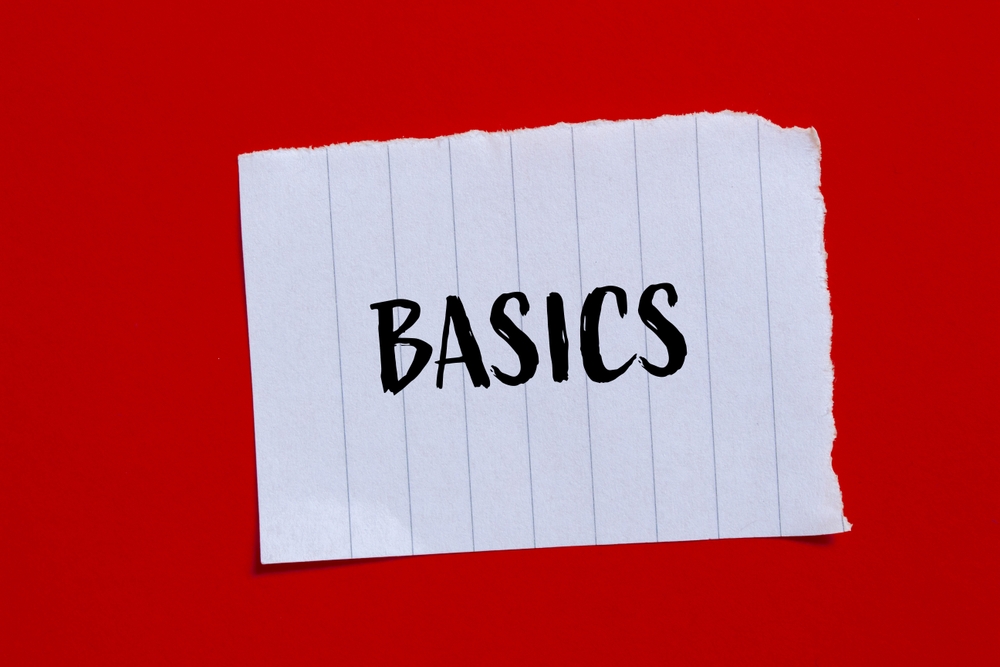

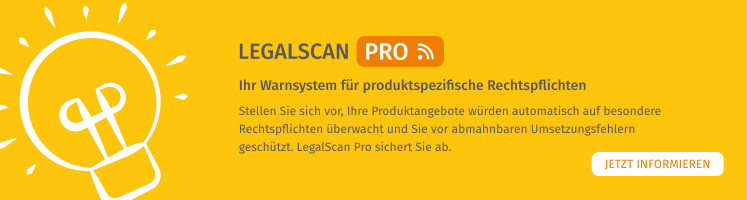

0 Kommentare