Riskantes Schnäppchen - aktuelle Entscheidung zur Nutzung von „gebrauchter Software“

Schon seit längerem ist es umstritten, ob der Verkauf von gebrauchter Software rechtlich zulässig ist oder nicht. Anbieter von gebrauchter Software werben damit, dass die Käufer bis zu 50 Prozent sparen könnten.
In dem Verfahren, aus welchem sich viele eine Klärung dieser Thematik erhofft hatten, hat der zur Entscheidung berufende Bundesgerichtshof (BGH) Anfang des Jahres ausschlaggebende Fragen dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) zur Beurteilung vorgelegt (siehe eigener Artikel ). Damit wird das Verfahren erst nach der Klärung dieser Fragen durch den EuGH entschieden. Dies kann allerdings noch einige Zeit dauern.
In der Zwischenzeit hat nun das Landgericht Frankfurt am Main Anfang Juli eine Entscheidung (Az.: 2-06 O 576/09) in einem ähnlichen Verfahren getroffen. Der Käufer einer „gebrauchten Software“ wurde darin wegen Nutzung dieser zu Unterlassung, Auskunftserteilung und Löschung der installierten Software verurteilt.
Der Sachverhalt
Der Beklagte kaufte bei einem Anbieter von „gebrauchter Software“ eine solche. Der Anbieter stützt sein Geschäftsmodell auf Entscheidungen deutscher Gerichte, die den Gebrauchthandel von Software als zulässig einstuften. Der Anbieter liefert dem Kunden neben der gebrauchten Software ein notarielles Testat. Der Anbieter beschreibt dieses wie folgt:
Vom Verkäufer der Softwarelizenzen wird vor dem Notar urkundlich bestätigt, dass er rechtmäßiger Inhaber der Softwarelizenzen ist und die Nutzungsrechte existieren. Dabei werden u.a. Lieferscheinnummer und Bestellnummer angegeben. Der Verkäufer bestätigt außerdem, dass die Softwarelizenzen nicht mehr verwendet werden und lizenzierte Programme vollständig von seinen Rechnern entfernt wurden..
Kläger in diesem Verfahren war der Softwarehersteller.
Die Entscheidung
Das LG Frankfurt ist der Meinung, dass der Beklagte (Käufer) die Rechtmäßigkeit des Erwerbs seines Nutzungsrechts an der Software nicht nachweisen konnte. Dazu sei er jedoch nach der Rechtsprechung des BGH verpflichtet. Das vom Beklagten zum Zwecke des Nachweises vorgelegte notarielle Testat genüge dem nicht. Der Beklagte hätte insbesondere die ganze „Rechtekette“, also den Rechteerwerb von ihm bis zum ersten Erwerber lückenlos nachweisen müssen.
Rechtlich geht es bei dieser Thematik um die Frage, ob hinsichtlich einer online-weitergegebenen Software der Erschöpfungsgrundsatz gilt (gelten sollte) und ob dieser Grundsatz auch hinsichtlich des Vervielfältigungsrechts gilt (siehe eigener Artikel ).
Die Software-Hersteller begrüßten diese Entscheidung. Den Nutzer von gebrauchter Software dürfte diese Entscheidung eher Sorgen bereiten. Eine höchstrichterliche Entscheidung steht jedoch immer noch aus.
Fazit:
Nun wissen also alle Softwarekäufer, dass sie um ganz sicher zu gehen, dass sie auch tatsächlich die erworbenen Rechte erhalten, den Rechteerwerb bis zum ersten Erwerber lückenlos nachweisen müssen.
Diese Forderung scheint schon unzumutbar, ist aber in der Logik nicht zu Ende geführt, denn auch beim ersten Erwerb kann der Lizenznehmer nicht sicher sein, dass der Verkäufer über die beanspruchten Rechte auch wirklich verfügt. Hat er zum Beispiel wirklich mit allen freien Mitarbeitern ausreichende Lizenzvereinbarungen getroffen?.
Tipp: Fragen zum Beitrag? Diskutieren Sie hierzu gerne mit uns in der Unternehmergruppe der IT-Recht Kanzlei auf Facebook .
Link kopieren
Als PDF exportieren
Per E-Mail verschicken
Zum Facebook-Account der Kanzlei
Zum Instagram-Account der Kanzlei
Beiträge zum Thema






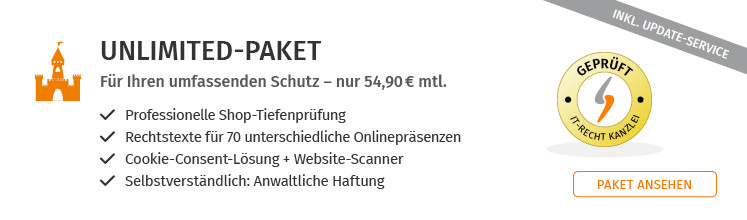

0 Kommentare