EU-Spirituosenrecht: Wann darf Rum als Rum bezeichnet werden?

Rum klingt nach Exotik – ist aber ein geschützter Begriff. Nur Produkte, welche die entsprechenden EU-Kriterien erfüllen, dürfen so bezeichnet werden. Was gilt und wo Risiken lauern, zeigt dieser Beitrag.
Inhaltsverzeichnis
Problemstellung
Genussmittelhersteller, aber auch Anbieter von Genussmitteln sehen sich häufig einer Vielzahl von Regelungen gegenübergestellt, die oftmals nicht auf den ersten Blick zu durchdringen sind.
Nicht nur technische Verfahrensanforderungen müssen beachtet werden, auch den Verbraucher- und Wettbewerberschutz gilt es zu wahren.
Dabei rücken immer mehr europäische Regelungen in den Vordergrund. Gleichzeitig steigt der Konkurrenzdruck - gerade im Online-Geschäft und besonders, wenn das sog. Geoblocking verboten wird. Innovative Verfahrenstechniken und schlagkräftige Werbeaussagen erleichtern sicherlich das Geschäft. Gleichzeitig bringt die fortschreitende Globalisierung des Handels zahlreiche Herausforderungen mit sich, gerade was Qualitätsstandards anbelangt.
So stellt sich beispielsweise die Frage, ob die gerade für Cocktails beliebte und im Volksmund als „Stroh Rum“ bezeichnete Spirituose aus Österreich nach europäischem Recht überhaupt ein „Rum“ ist und als solcher vermarktet werden darf.
Geregelt wird dies in der europäischen „Spirituosen-Verordnung“– genauer der Verordnung (EU) 2019/787 zur Begriffsbestimmung, Bezeichnung, Aufmachung und Etikettierung von Spirituosen sowie zum Schutz geografischer Angaben für Spirituosen.
Rechtliches
Die Nichtbeachtung der Vorschriften nach der Spirituosen-Verordnung kann Abmahnungen nach dem UWG nach sich ziehen. Doch was heißt das konkret?
Am Beispiel des sog. Stroh-Rums zeigt sich anhand von Art. 10 im Zusammenhang mit den Kategorien des Anhangs I der Verordnung folgendes Bild:
Bei den Spirituosen der Marke „Stroh“, insbesondere „Stroh 40“ bzw. „Stroh 80“, handelt es sich nicht um (echten) Rum im Sinne der Verordnung, sodass eine Vermarktung und Bewerbung als Rum unzulässig ist.
In Art. 10 Abs. 2 der VO heißt es:
„Spirituosen, die den Anforderungen einer Spirituosenkategorie gemäß Anhang I genügen, verwenden die Bezeichnung dieser Kategorie als ihre rechtlich vorgeschriebene Bezeichnung.“
Nr. 1 des Art. 4 der Verordnung definiert Bezeichnungen wiederum als Begriffe, die für ein Getränk in der Kennzeichnung, Aufmachung und auf der Verpackung, in den Begleitpapieren beim Transport eines Getränks, in den Geschäftspapieren, insbesondere den Rechnungen und Lieferscheinen, sowie in der Werbung dafür verwendet werden.
Kurz gesagt: Nur wo Rum drin ist, darf auch Rum drauf stehen.
In Kategorie 1 des Anhangs II der VO wird echter Rum schließlich wie folgt definiert:
"Rum ist eine Spirituose, die ausschließlich durch die Destillation des Produkts der alkoholischen Gärung von Melasse oder Sirup, die aus der Rohrzuckerproduktion stammen, oder von Zuckerrohrsaft selbst gewonnen und zu weniger als 96 % vol so destilliert wird, dass das Destillat in wahrnehmbarem Maße die besonderen sensorischen Eigenschaften von Rum aufweist."
Außerdem muss Rum einen Mindestalkoholgehalt von 37,5 % vol aufweisen und es darf kein zusätzlicher, nicht aus Zuckerrohr stammender Alkohol zugesetzt werden; eine Aromatisierung ist nicht zulässig, lediglich Zuckerkulör zur Farbangleichung und eine begrenzte Süßung zur Abrundung des Geschmacks sind erlaubt.
Schon aufgrund der zugefügten Aromen und Essenzen ist der „Stroh“ jedoch kein Rum und darf daher nicht als solcher vermarktet werden.
Somit gilt für den „Stroh“ Art. 10 Abs. 3 der VO, der besagt, dass die im vorliegenden Beispielsfall einzig korrekte Bezeichnung schlicht „Spirituose“ wäre und nicht mit dem Zusatz Rum verbunden werden darf:
"Die rechtlich vorgeschriebene Bezeichnung einer Spirituose, die den Anforderungen keiner Spirituosenkategorie gemäß Anhang I genügt, lautet „Spirituose“."
Fazit
Genussmittel unterliegen heutzutage mehr denn je strengen Reglementierungen, die nicht nur Hersteller, sondern auch Händler vor Herausforderungen stellen.
Werbung mit Gütesiegeln und Verweisen auf heimische Produktion o.ä. mögen zwar in vielen Fällen das Geschäft ankurbeln können, doch dürfen Verkehrsbezeichnungen nach der „Spirituosen-Verordnung“ weder ersetzt noch geändert werden und schon eine Einstellung eines Produkts in einer falschen Kategorie im Online-Shop kann abgemahnt werden.
So können auch beispielsweise inlandsbezogene Bezeichnungen verknüpft mit dem Wort Rum schnell zum Bumerang werden, wenn nämlich – wie im Fall des fälschlicherweise als „Rum“ bezeichneten „Strohs 40“ beispielsweise – bestimmte, z.B. an eine Herkunftsregion anknüpfende Verbrauchererwartungen nicht erfüllt werden.
Eine fachkundige Beratung im Vorfeld ist insbesondere für die rechtssichere Gestaltung von Online-Angeboten hilfreich und wichtig, um kostspielige Abmahnungen zu vermeiden, denn nicht nur das EU-Spirituosenrecht kann eine Rolle spielen, sondern auch nationale Regelungen (§§ 126, 127 MarkenG) .
Fragen zum Beitrag? Diskutieren Sie hierzu gerne mit uns in der Unternehmergruppe der IT-Recht Kanzlei auf Facebook.
Link kopieren
Als PDF exportieren
Per E-Mail verschicken
Zum Facebook-Account der Kanzlei
Zum Instagram-Account der Kanzlei

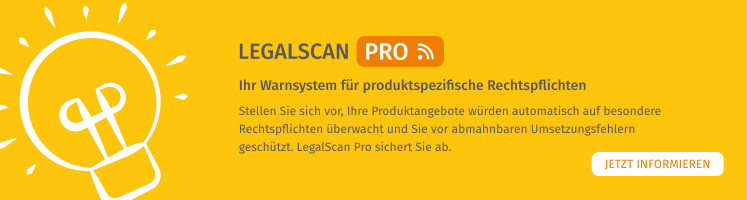




1 Kommentar